Volker Grassmuck
für
Stanca Scholz-Cionca (Hrsg.) "Japan, Reich der Spiele"
Iudicium Verlag, München 1998
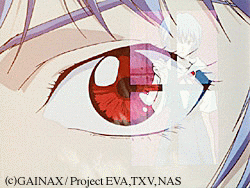
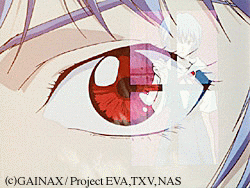
| Jacopo Belbo war nicht verrückt, er hatte einfach beim Spielen,
durch das Spiel, die Wahrheit entdeckt.
Umberto Eco
|
"Das Spiel ist ein Naturphänomen, das von Anbeginn den Lauf der Welt gelenkt hat: die Gestaltung der Materie, ihre Organisation zu lebenden Strukturen wie auch das soziale Verhalten der Menschen." Den Nobelpreisträgern Manfred Eigen und Ruthild Winkler [1975: 17] zufolge kann man das Spiel also gar nicht grundlegend genug ansetzen. Regel und Zufall sind seine Elemente, wenn auch das Spiel weder mit der einen noch dem anderen identisch ist. Das sture Befolgen von Regeln wird gewöhnlich mit dem mechanischen Lauf der Maschine assoziiert. Der Vorwurf, daß sie deshalb keine Schönheit, Mannigfaltigkeit, Intelligenz - kurz, nichts Menschliches hervorbringen könne, bewegte den Erfinder der Universalmaschine Computer dazu, den Gegenbeweis anzutreten. Alan Turing beschäftigte sich in den 1940er Jahren damit, Elektronengehirnen Schach, Dame und Tic-Tac-Toe beizubringen. "Der Leser könnte sich wohl fragen, weshalb wir uns mühen, diese komplizierten und teuren Maschinen zu einem so trivialen Zeitvertreib zu verwenden, wie Spiele zu spielen. Es wäre unaufrichtig von uns zu verschleiern, daß das hauptsächliche Motiv, das den Anstoß zur Arbeit gab, der reine Spaß an der Sache war, aber nichtsdestotrotz könnten wir, wenn wir jemals Zeit und Aufwand zu rechtfertigen hätten (und wir empfinden tief, daß Entschuldigungen weder notwendig noch verlangt sind), leicht einen Vorwand dafür finden." [1987: 118] Und einige Zeilen später liefert er ihn dann doch, indem er auf den Nutzen der Spielerei für die Programmierung im Dienste von Geschäft und Wirtschaft, "vielleicht sogar, bedauerlicherweise," in der Kriegstheorie verweist.
Krieg und Spiele, Wirtschaft und Wissenschaft - damit sind die Koordinaten
abgesteckt, in denen der Computer die Welt erobern wird. Das folgenreichste
Spiel jedoch, das Turing erdachte, läßt Mensch und Computer
einander imitieren.(1) Der Turing-Test hat
in immer neuen Varianten bis heute Versuche hervorgebracht, mit Hilfe immer
subtilerer Verbindungen von Regel und Zufall den Begriff des Menschen mit
dem der Maschine zur Deckung zu bringen. Eine Lust am Spiel mit der und
gegen die Maschine sollte den Lauf der Welt bis heute lenken - eine Lust,
die keiner weiteren Rechtfertigung bedarf.
Durch den Spiegel
Der Weg von den frühen Elektronenröhren- und Lochkarten-Computern zu Nintendo führt über die Kopplung von Rechner und Fernseher. Die PDP-1 war der erste Mini-Computer, der seine Ausgabe instantan auf einer Kathodenstrahlröhre darstellte. Als sich Forscher am Labor für Künstliche Intelligenz des Massachusetts Institute of Technology 1962 fragten, was sie mit den neuen Möglichkeiten anstellen sollten, erfanden sie - ganz im Geiste Turings - das erste Videogame "Spacewar". Lichtpunkte repräsentierten dabei Raumschiffe und Lasergeschosse. Das Wort Interaktivität sollte erst Jahre später geprägt werden, doch daß die simple Grafik auf dem Schirm direkt manipulierbar war, löste zum ersten Mal die süchtigmachende Spannung, Action und Faszination aus, die Millionen von Videospielern vor den Monitoren hält. Brenda Laurel entwickelt aus dieser Beobachtung ihre These vom Computer als theatralischem Handlungsraum [1991: 1]. Ein japanischer Fernseh-Clip von 1992 brachte den Effekt auf die treffliche Formel "osu, ugoku, ureshii" (Ich drücke, etwas bewegt sich, ich freue mich).
"Spacewar" verbreitete sich rasch in den Informatiklabors der amerikanischen Universitäten. Einer, der es dort gespielt hatte, Nolan Bushnell, lötete 1972 aus einem Fernseher und einer Platine das Lichttennisspiel "Pong" zusammen und gründete Atari. Der Rest ist Legende. Eine neue Industrie war geboren. Ex-Atari-Angestellte trugen den Impuls zu Electronic Arts, Lucasfilm, Microsoft und Apple, darunter Steve Jobs und Steve Wozniak, die neben ihrer Arbeit am Atari-Game "Breakout" den ersten persönlichen Computer bastelten. Bald stiegen Industriegrößen wie RCA und National Semiconductor in den boomenden Markt ein, und Warner Communications kaufte Atari. 1982 gaben Amerikaner drei Milliarden Dollar für Heim-Videogames aus und steckten fünf bis sechs Milliarden in Münzspielautomaten.
Auch in Japan tauchten "Pong" und "Breakout" (unter dem Namen Burokku kuzushi) bald neben Pinball- und Jukebox-Geräten in Cafes und Bars und in den Kaufhäusern auf. Einer der Lizenznehmer von Atari war Nintendo. 1889 gegründet stellte das Familienunternehmen hanafuda und später als erste japanische Firma auch westliche Spielkarten her. In den Sechzigern versuchte sich Nintendo mit mechanischem und elektronischem Spielzeug. 1977 sprang es auf den Markt für Heimvideospiele auf. "Color TV Game 6" wurde an den Antenneneingang eines Fernsehers angeschlossen und enthielt neben den beiden Klassikern noch vier weitere festverdrahtete Spiele.
Das von Taito 1978 vorgestellte "Space Invaders" war der erste japanische Spiele-Hit. Kolonnen von Außerirdischen mußten mit einer beweglichen Kanone am unteren Bildrand abgeschossen werden. Als Tisch- und Standgerät und bald auch in Farbe zog es einen unaufhörlichen Strom von Hundert-Yen-Stücken an. Pachinko-Hallen bekamen Konkurrenz durch Dutzende "Invader-Houses", die ersten reinen Videospiel-Arkaden, aus denen die heutigen wie Raumstationen anmutenden "Freudenstädte" (s. Segas Joypolis) hervorgegangen sind. Zwei Jahre später folgte mit "Pac-Man" der erste japanische Welterfolg. Der gefräßige gelbe Kreis bahnte sich einen Weg in Fernsehprogramme, auf T-Shirts und die Titelblätter von Nachrichtenmagazinen und machte Namco für eine Zeit zum erfolgreichsten Videospielunternehmen der Welt.
Nintendos erster Erfolgstitel für Spielhallengeräte hieß "Donkey Kong" (1981). Entworfen wurde es von Miyamoto Shigeru, der gerade nach seinem Studium als Industrie-Designer von Nintendo-Chef Yamauchi eingestellt worden war. Seit Schulzeiten hatte Miyamoto leidenschaftlich manga gezeichnet. Die üblichen Shoot-'em-up- und Tennis-Games fand er langweilig. Er wollte Spiele entwerfen, die Märchen und Epen und Kinofilmen gleichen. "The Beauty and the Beast" inspirierte ihn zu der Figur des schlauen Gorillas, der seinem gemeinen, kleinen Herrchen die schöne Freundin entführt - um ihn zu ärgern, nicht etwa um ihr etwas zuleide zu tun. Die Spielfigur, ein gewöhnlicher etwas tapsiger Zimmermann im Overall, hat nichts von einem klassischen Helden. Miyamoto beschreibt ihn als so durchschnittlich, daß sich jeder mit ihm identifizieren könne. "Donkey Kong" ist ein, wie es im Branchen-Jargon heißt, Jump-'n'-Run, bei dem der Spieler seine Figur über Leitern und Fließbänder führen und dabei Bonuspunkte einsammeln und den Gegenständen ausweichen muß, die Kong ihm entgegenwirft. Es wird nicht nur in Japan zum großen Hit, sondern verhilft trotz seines wenig erfolgversprechenden Namens auch dem neugegründeten Nintendo of America zum Durchbruch. Bei der Übersetzung des Game-Textes ins Englische erhielt der Zimmermann, der später zum Klempner umschulte, übrigens den Namen Mario.
Mit dem Famicon (Family Computer, 1983) errang Nintendo schließlich die Führungsposition im japanischen Videogame-Markt. Die Heimkonsole verfügte über einen 8-Bit-Prozessor, austauschbare Spiele-Cartridges und eine Schnittstelle für Zusätze wie Modem oder Tastatur, weshalb das unschuldig daherkommende Spielzeug auch als 'Yamauchis Trojanisches Pferd' bezeichnet wurde. Er kalkuliere, so die Unterstellung, daß Kinder, die mit Nintendo-Games aufgewachsen sind, später auch seriöse Computeranwendungen, Banktransaktionen und elektronische Post mit dem Famicon ausführen würden. Bessere Graphik, mehr Farben und ein niedrigerer Preis als die Videospielsysteme der amerikanischen und einheimischen Konkurrenten, vor allem aber Erfolgsspiele wie "Legend of Zelda" und "Metroid" sorgten dafür, daß japanische Kinder bald nichts anderes mehr spielen wollten.
Das Videospiel am Fernseher erlaubte es erstmals, in den medialen Raum hinter der Scheibe hineinzugreifen. Wie Alice kann der Spieler durch den Spiegel gehen und in eine fremdartige, neue Welt eintreten. Schon der Fernseher hatte die Sozialordnung im japanischen Wohnraum umgewälzt. Als er in den 60er Jahren seinen Platz in der tokonoma zugewiesen bekam, öffnete er den Zirkel um den kotatsu, verdrängte die Gottheit und den Vater von ihrem Ort der Autorität und lenkte alle Aufmerksamkeit frontal auf sich. Die Spielkonsolen, die in den achtziger Jahren in fast allen japanischen Haushalten auftauchen, verwandeln die Bilderwelt des Fernsehers in einen Handlungsraum und die tokonoma von einem Ort der Kontemplation über den einer Zerstreuung jetzt in einen der geradezu tranceartigen Bündelung von Aufmerksamkeit. Der Spieler sitzt jetzt unter Ausschluß aller Kommunikation mit anderen Anwesenden gebannt vor dem Bildschirm auf dem Boden. An der Nabelschnur des Game-Kontrollers hängend bildet sich ein sensorischer Rückkopplungskreis von Körper, Maschine und Phantasie. Die physische Anwesenheit vor dem Bildschirm verlagert sich in eine repräsentationelle Anwesenheit im symbolischen Raum der Maschine, in Brenda Laurels Begriffen vom Menschen zum menschlichen Aktor. Die eigene Spielfigur begegnet innerhalb der Anderwelt des Spiels anderen Aktoren, die auf das eigene Verhalten reagieren. Ob man sich mit ihnen im Zweikampf mißt oder gemeinsam mit ihnen Abenteuer besteht, sie erscheinen als autonomes Gegenüber. Sie gleichen den Figuren, die beim Brettspiel gezogen werden, nur ist es hier der universelle Simulator, der sie führt. Der Computer hat in den Form des Spiels den Turing-Test bestanden. Eine Generation übt sich an den kognitiven Trainingsmaschinen in das Handeln innerhalb eines Nicht-Ortes aus Bits ein, der aber gleichwohl als Anwesenheitsraum erfahren wird.
Der Illusionsmaschine Fernsehen wird eine entscheidende Dimension hinzugefügt,
die der Simulation. Erstmals können Spieler im selben Szenario alternative
Pfade und verschiedene Rollen durchspielen. Sie können "was-wäre-wenn"-Fragen
ausprobieren - etwas, vor dem die japanische Kultur, so der Management-Guru
und Globalisierungsprophet Ohmae Kenichi, durch den Shintô-Glauben
zurückschrecke, demzufolge etwas auszusprechen bedeutet, es geschehen
zu lassen. Games geben den Kindern die Möglichkeit, mit jeder neuen
Runde verschiedene Optionen abzuwägen und die entsprechenden Resultate
zu beobachten. Sie lernen auch, daß die Grundregeln des Spiels revidierbar
sind. Für einen Computerspieler ist Programmieren das ultimative Game.
"Dies bringt das Bildungsministerium in eine peinliche Lage, das fortfährt
die Kinder so zu unterrichten, als gäbe es auf jede Frage eine Antwort.
Kinder mit einem guten Gedächtnis kommen voran. Aber nicht mit Nintendos
und Segas. Diese fordern zum ersten Mal in Japan seit der Steinzeit Jugendliche
in ihrer Gesamtheit dazu heraus, ihren eigenen Weg zu finden. Die Technologie
hat ihnen erlaubt, auf eine höchst un-japanische Weise selber zu definieren,
zu formen, zu bewerten und - infrage zu stellen." [Ohmae 1994]
Aufgang der Videogame-Sonne
Just als Nintendo die Einführung des Famicon auf dem US-amerikanischen Markt vorbereitete, brach dieser zusammen. 1983 schrumpften die drei Milliarden Dollar aus dem Vorjahr auf Hundert Millionen. Die Scherben wurden zusammengekehrt und innerhalb weniger Monate zogen sich fast alle Hersteller aus dem Markt zurück. Die allgemeine Einschätzung lautete, Heim-Videogames waren kein Markt, sondern eine flüchtige Mode gewesen. Nach einer anderen Beobachtung hatte die Gier des Goldrausches zu einer Flut von hastig produzierten Spielen geführt, die den wachsenden Ansprüchen der jugendlichen Konsumenten nicht genügten, zu Überproduktion und schließlich zu Dumping. Yamauchis Einschätzung schließlich war, daß Kinder in Amerika nicht anders seien, als die in seinem eigenen Land. Auch daß die Spielhallen ebenso gut besucht waren wie vor dem Crash zeigte, daß nicht die Games als solche Schuld gewesen sein konnten.
Unter Leitung von Yamauchis Schwiegersohn bereitete Nintendo of America die Lancierung der Konsole sorgfältig vor. Um jede Assoziation mit der Atari-Pleite zu vermeiden, wurde sie "Nintendo Entertainment System" (NES) getauft. Auch wie ein Computer, zu dem viele in Europa und den USA inzwischen überwechselten, sollte sie nicht erscheinen. 1982 hatte Commodore mit dem C64 den ersten echten Heimcomputer auf den Markt gebracht, der mit siebzehn Millionen Stück weltweit auch gleich der erfolgreichste aller Zeiten wurde. Besonders in Japan, wo sich die Schreibmaschine nie verbreitet hatte und der erste Kanji-Code für den Computer erst kurz zuvor standardisiert worden war, herrschte Tastaturangst. Als 1984 der erste wapuro erschien, den sich private Nutzer leisten konnten, war Japans Jugend bereits am Knopfkontroller sozialisiert. Auch als Nintendo das NES schließlich zum Weihnachtsgeschäft 1985 in den USA vorstellte, wurde statt der bereits entwickelten Tastatur nur ein Zapper-Gewehr und ein Roboter als Zubehör angeboten. "Super Mario Bros." gab es zur Konsole dazu. "Zelda" und "Mike Tyson" waren bereits bewährte Software-Titel. Trotz großem und innovativem Marketingaufwand sagten Industriebeobachter und selbst die eigene Marktforschung den Fehlschlag voraus.
Sie sollten sich irren. Im ersten Jahr wurden eine Million NES in den USA verkauft, im zweiten drei und insgesamt weltweit 62 Millionen, dazu mehr als 500 Millionen Game-Cartridges. 1990 gab es in jedem dritten amerikanischen Haushalt ein Nintendo-Gerät und 1992 produzierte der Heim-Game-Markt wieder fünf Milliarden Dollar Umsatz [Sheff 1993: 172]. Nintendo-Games wurden zum größten kulturellen Exportartikel Japans. Sega, NEC, Sony und Matsushita traten mit eigenen Konsolen gegen Nintendo an. Seit dem Crash haben japanische Hersteller das weltweite Monopol auf dem Videogame-Markt, der 1996 einen Jahresumsatz von fünfzehn Milliarden Dollar einfuhr.
Das Volumen erhöht sich noch einmal, rechnet man die 'intertextuelle' Mehrfachverwertung der popularkulturellen Ikonen hinzu. Super Mario hat unter amerikanischen Kindern einen höheren Wiedererkennungswert erlangt als die heimische Mickey Mouse [Sheff 1993: 9]. Dieses Kapital wird durch merchandizing, also Fan-Artikel wie Tassen und T-Shirts, Puppen und Bettwäsche, und durch branding, also die Verwendung von Mario und anderen Ikonen durch Pepsi oder McDonald's in bare Münze übersetzt. Die Kulturindustrie steigert sich durch Verbundsysteme der Medien zu neuen Höhen. Spieler müssen die Hauszeitschriften von Nintendo und die Anleitungsbücher lesen, um in den vollen Genuß von Geheimtüren und Tastenkombinationen zu gelangen. Als 1998 Universal in dem Film "The Wizard" das noch nicht erschiene "Super Mario Bros. 3" in der Hauptrolle zeigte, profitierten Hollywood und Kyoto aneinander. Aus der Musik, die sich beim Spielen ins Ohr bohrt, werden Erfolgstitel auf CD. Und selbst die Telefon-Hotline zur Beratung von Spielern und Eltern entwickelte sich zu einer erheblichen Einnahmequelle.
Elektronische Games werden in jedem Land der Erde und in jedem Gesellschaftssegment
vom Dreijährigen bis zum seriösen Geschäftsmann gespielt.
Die mächtigsten Prozessoren und die neusten Multimedia-Technologien
verbreiten sich in der Form von Spielzeug. Der Weg in die sogenannte Informationsgesellschaft
scheint durch die Labyrinthe und Rennstrecken der simulierten Spielewelten
zu führen. Zentrales Emblem der Globalisierung sind für Ohmae
Kenichi die Nintendo-Kids, die mehr mit ihren Altergenossen in anderen
Ländern gemein haben als mit den vorangegangenen Generationen in ihrer
eigenen Kultur [Ohmae 1994]. Wir haben es mit wahrhaft ludischen Zuständen
zu tun.
Harte und softe Spiele
Games sind, wie jedes Medium, ein Phänomen aus Hardware und Software. Nintendos Erfolg beruht nicht zuletzt darauf, diese Kopplung gekonnt auszuspielen. Games besonders für PCs wurden seit ihrer Erfindung kopiert und weiterverschenkt. Nintendo erfand dagegen eine Hardwaresicherung, bei der ein proprietärer Schlüssel-Chip auf der Game-Platine mit einem Schloß-Chip in der Basisstation kommuniziert. Passen die beiden nicht zusammen, lehnt der Famicon das nicht-autorisierte Game ab. Damit versuchte Nintendo nicht nur eine Flut von Raubkopien aus Taiwan oder den USA abzuwehren, sondern sicherte sich auch die Kontrolle über Qualität und Menge und eine Gewinnbeteiligung an jeder legal für seine Plattform produzierten Software. Vorwürfe gegen dieses Bundling von Soft- und Hardware wurden laut, wie sie sich Ende der sechziger Jahre schon gegen IBMs Monopolstrategie gerichtet hatten, nur daß sie im Falle Nintendos bislang folgenlos blieben. Namco hat als einziges Lizenz- oder besser Zulieferunternehmen von Nintendo gewagt, das Recht einzuklagen, eigene Cartridges für den Famicon zu produzieren. Nach seinem Rückzieher wußte die gesamte Branche sich in ihre Schranken gewiesen [Sheff 1993: 74f.].
Hardware ist das Gefäß, das den Inhalt schützt und wohlgefällig präsentiert. Wie bei Computern wird die Rechenleistung der Game-Konsolen ständig aufgerüstet, vor allem im Dienste einer schnelleren, dreidimensionalen, photorealistischen Graphikdarstellung. Doch wie leistungsfähig das Gerät auch sein mag, letztlich ist der Erfolg wie bei jedem Medium Software-getrieben. Die "Spielbarkeit" eines Games ist eine diffizile, emotionale und ähnlich einem künstlerischen Werk schwer vorauszuberechnende Qualität, die alles entscheidet.
Um Spannung zu erzeugen braucht jede gute Geschichte einen Konflikt und eine Lösungsstrategie, vom einfachen Ballern bis zu komplexen diplomatischen Manövern. Games unterliegen Moden, ihre Grundstrukturen nicht. "Die heutigen Bestseller sind Varianten von Spielen, die wir im College mit Papier und Bleistift gespielt haben," sagt Henk Rogers, Rollenspielautor und Chef von Bullet-Proof Software in Yokohama [Asahi 28.3.93]. Kein Land habe die Spiel-Kreativität für sich gebucht. So läßt er Software in Holland, Polen und England entwickeln und hat zehn Informatiker in Moskau unter Vertrag.
Huizingas Taxonomie der Spieltypen ist weitgehend auch auf Computer-Games anwendbar. So gehören Zweikampfspiele wie "Street Fighter" (Capcom) oder die dreidimensionale Version "Virtua Fighter" (Sega) zu den erfolgreichsten. Ebenso Labyrinthe und Geschicklichkeitsspiele wie "Super Mario". Klassiker wie Schach und Go, Poker und Mahjong tauchen in elektronischer Form wieder auf, letztere nicht selten mit einer erotischen Umrahmung. Mit "Pong" hatten Videogames überhaupt angefangen und zugleich eine Kategorie von Sportsimulationen, die heute bis zu den sogenannten taikan geemu reichen, Spielhallengeräte mit aufwendigen hydraulischen Schnittstellen für das Körpergefühl beim Surfen, Motorradrennen oder Reiten. So steuert die Spielerin die Bretter bei Segas Ski-Simulator durch Gewichtsverlagerung und hat den Eindruck, tatsächlich den Hang hinunter zu wedeln, der vor ihr auf dem Bildschirm abrollt.
Unter den kombinatorischen Spielen haben die fallenden Puzzlesteine von "Tetris" eine Klasse für sich geschaffen. Von Alexei Pajitnov am Computerzentrum der Moskauer Akademie der Wissenschaften geschrieben verbreitete es sich als Freeware in russischen Informatikerkreisen ebenso lauffeuerartig, wie zuvor "Spacewar" in den USA [s. Sheff 1993: 296]. Nintendo entdeckte es als das ideale Game für den grobauflösenden LCD-Schirm des Taschengeräts Gameboy (1989) - ein mediengerechter Content für eine neue Hardware.
Rollenspiele stießen in Japan zunächst auf Unverständnis. Das Genre geht zurück auf das 1973 von zwei Kaliforniern entwickelte "Dungeons & Dragons", das von einer Gruppe aus Elfen, Zauberern und Kobolden mit einem zwölfseitigen Würfel, einem Regelbuch und einem Spielleiter über Wochen und Monate mehr gelebt als gespielt wird. Henk Rogers schrieb in Yokohama eine PC-Version dieses an Tolkien angelehnten Szenarios, aber hatte Mühen, die Redakteure von Game-Zeitschriften davon zu überzeugen und schließlich 100.000 Kopien von "Black Onyx" (1980) zu verkaufen [Sheff 1993: 63f.].
Erst "Dragon Quest" (Enix, 1986, für Famicon und MSX) löste in Japan einen Rollenspiel-Boom aus. Von "DQ1" verkauften sich 1,4 Millionen, von der nächsten Folge 2,3 Millionen und von der dritten 3,4. Als im September 1992 der Verkaufsbeginn von "Dragon Quest V" angekündigt wurde, bildeten sich Tage vorher Schlangen, 10.000 Menschen allein vor einem Discount-Laden in Tokyos Ikebukuro. Dreizehnjährige, die keines abbekommen hatten, überfielen Altergenossen, um sich das Game zu beschaffen. "Dora kue" wurde zu einem Fan-Kultobjekt ähnlich der "Starwars"-Serie. Doch während sich das amerikanische SF-Imaginäre in den narrativen Formaten des Kinos und Fernsehens bildet und nur sekundär auch in Starwars-Games mehrfachverwertet wird, geht hier das Game dem Film voraus. Der DQ-Spielfilm (Gainax) wurde 1989 mit einem Konzert des "DQ Orchestra" und Fans, die in den Kostümen ihrer Lieblingsrollen posierten, uraufgeführt.
Das DQ-Szenario von Horii Yûji bleibt dem ursprünglichen D&D-Geist treu. Zwei Prinzen und eine Prinzessin haben die Mission, die Welt von den Aposteln des Dämons Hagon vom Ise Schrein zu befreien und ihr den Frieden wiederzubringen. Dazu reisen sie auf einer ausgedehnten Landkarte, erforschen Schlösser und Städte, Höhlen, Verließe und Türme, lösen Rätsel und Puzzle und kämpfen mit Monstern. Rollenspiele kombinieren also verschiedene Spielelemente um den Lebensweg des eigenen Avatars herum, wie die Repräsentation des Spieler-Ichs gemeinhin genannt wird. Auf dem Weg der Vervollkommnung sammelt der Avatar Kraft, Kampferfahrung, Intelligenz usw. und er muß mit seinen Bundesgenossen kooperieren. Gerade diese emotionale Teamqualität wird als Grund für den überwältigenden Erfolg des Spiels in Japan angeführt. Ein Handbuch der Game-Kultur herausgegeben vom "TV-Game-Museum Projekt" erklärt das "DQ-Phänomen" damit, daß es in der "japanischen Erde" verwurzelt sei. DQ entspreche vollkommen der Sensibilität und dem Geschmack der Japaner. Die Gestaltung der Figuren stelle "Gefühl und Blutsverwandtschaft" ins Zentrum und der Spielverlauf belohne "Anstrengung und Aufrichtigkeit". Auf diese Weise aus der Bildlichkeit des europäischen Mittelalters herausgelöst und der japanischen Tradition assimiliert kann Horii von DQ sagen: "Wir haben ein Game geschaffen, bei dem die Japaner mit aller Kraft ihren Spaß haben können." [TGM 1994: 82f.]
Mit DQ war der Weg für das vielfältige Genre der Rollenspiele eröffnet, zu dem z.B. die Geschichtssimulation "Nobunaga no yabô" (Nobunagas Ambitionen) (Kôei, 1993) gehört. Weitgehend historiengetreu muß der Spieler im Dienste von Reichseiner Oda Nobunaga (1534-1582) Aufstände und Seuchen bekämpfen, die Folgen von Naturkatastrophen lindern und politische Heiraten einfädeln. Während Flugsimulatoren und Systemsimulatoren wie "SimCity" in aller Welt auf Begeisterung stoßen, haben in Japan in der Zeit der Spekulationsseifenblase der achtziger Jahre Börsensimulationen eine besondere Funktion erlangt. Zwar mag sich in einer Rahmengeschichte mit einer schönen Frau als Siegprämie auch hier ein Rest von Spielhaftigkeit erhalten haben. Im Vordergrund stehen jedoch Edutainment und Realismus, die die Spieler massenweise auf das große Spiel an der wirklichen Börse vorbereitet haben.
Schließlich ist noch eine weitere soziale wie technische Dynamik der Games anzusprechen: seit Mitte der achtziger Jahre gehen sie ins Datennetz. Auch hier war es "D&D", das die naheliegende Kopplung von Narrations- und Interaktionsnetzen mit denen der Telekommunikation hervorbrachte. Die ersten "Multi User Dungeons" (MUDs) waren reine Textwelten, in denen die Spieler jedoch nicht nur vorprogrammierten Drachen und Gnomen, sondern auch den Avataren anderer menschlicher Spieler begegneten. Von regelbasierten Spielen im strikten Sinne verwandelte sich ein Teil der MUDs bald in soziale Experimentierfelder zwischen Spiel und Leben, "Identity Workshops" zum Ausprobieren von Rollen, Gender und möglichen Persönlichkeitsentwürfen [Bruckman 1992]. "Sie konstituieren weder eine Flucht aus der historischen Existenz noch sind sie einfach ihre elektronische Erweiterung, sondern vielmehr ein ständig umstrittenes Grenzgebiet zwischen den beiden - zwischen Geschichte und ihrer Simulation, zwischen Schicksal und Fiktion, zwischen den unausweichlichen Wendungen des Lebens und den endlos revidierbaren Möglichkeiten des Spiels." [Dibbell o.J.]
In einem weiteren Schritt wurde bei Lucasfilm, dem einflußreichen Game-Labor von Filmemacher George Lucas, die graphische Spielumgebung "Habitat" entwickelt. In dieser animierten Comic-Welt gibt es noch einige regelbasierte Spiele im Spiel, vor allem aber plaudern auch hier die Teilnehmer in Sprechblasen über ihren Avataren miteinander, treiben Handel, Kunst und Gruppenbildung. Habitat wurde von Fujitsu lizenziert, mit einer Eingabemöglichkeit für japanischen Text versehen und im Online-Dienst Niftyserve betrieben. 1990 hatte Fujitsu-Habitat 2000 regelmäßige Bewohner. Es fanden Haiku-Wettbewerbe statt, Hochzeiten und Scheidungen, Yakuza betrieben ein Spielkasino und aus einem spontanen Selbstregierungstrend heraus wurden Bürgermeisterwahlen abgehalten.(2)
MUDs kamen vor allem im universitären Teil des Internet auf, das
1994 einen späten aber mächtigen Start in Japan erlebte. Es gibt
sie zu Hunderten in aller Welt, nur in Japan konnten sie sich nicht recht
etablieren. Das inzwischen eingestellte "AndroMOO" an der Keio-Universität
und das "isMOO"
an der Tokushima-Universität sind in ihrer Abbildung des Campus realistisch
ausgelegt und dienen weniger dem Spielen als der Forschung über computergestützte
Bildung und kollaborative Arbeitsgruppen. Zwar gibt es ein Online-Rollenspiel,
das das übliche Setting im europäischen Mittelalter durch eine
Welt des japanischen fünfzehnten Jahrhunderts ersetzt, doch das läuft
in den USA.(3) An der Schwierigkeit der
Eingabe von japanischer Schrift in die MUD-Software kann es nicht liegen,
seit die notwendige Technologie an der Keio-Universität entwickelt
worden ist. Rollenspiele für PC und Video-Konsole sind ungeheuer beliebt
und auch die Online-Welt "Habitat" ist erfolgreich. Die vergleichsweise
hohen Telekommunikationskosten in Japan und eine restriktive Zugangspolitik
zum Internet an den Universitäten mögen eine Rolle gespielt haben.
Doch warum MUDs nicht zu einem festen Bestandteil der japanischen Spielkultur
geworden sind, bleibt letztlich rätselhaft.
Über die Erziehung von Prinzessinnen und anderen Haustieren
Alan Turing war überzeugt, eine intelligente Maschine könne man nicht programmieren, man müsse sie erziehen. Ein Lehrer solle eine weitgehend unstrukturierte "Kind-Maschine" unterrichten und ihre zunächst zufällig variierten Antworten durch Belohnung und Bestrafung steuern. Für den Anfang schien ihm eine sehr abstrakte Tätigkeit wie das Schachspiel als geeignete Aufgabe. Mit den besten Sinnesorganen ausgestattet, die für Geld zu haben sind, könne man sie auch in der englischen Sprache unterrichten [1987: 175 ff.]. Wie wenig Sprachvermögen eine Maschine benötigt, um von einem bereitwilligen menschlichen Gegenüber zu einer 'intelligenten Person' ergänzt zu werden, hat Joseph Weizenbaum mit seinem Programm ELIZA nachgewiesen [1977]. Turings Imitationsspiel testet eben nicht nur die Maschine, sondern auch den Menschen.


Was den Jungs ihre Prinzessinnen, sind - nicht nur - den Mädchen
ihre Tamagotchi. Das von Maita Aki entworfene und von Spielzeughersteller
Bandai 1996 im japanischen Markt lancierte Elektronikei beruht ebenfalls
auf dem Mechanismus der Erziehung. Auch hier muß Herrchen oder Frauchen
die Befindlichkeit des heranwachsenden Cyberkükens auf den Skalen
für Gewicht, Hunger, Disziplin oder Zufriedenheit ablesen und entsprechend
füttern, säubern, spielen, Medikamente verabreichen, das Licht
vor dem Schlafen ausschalten und schimpfen, wenn es grundlos piepst oder
nicht essen will. 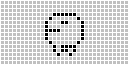 In
allen elektronischen Spielen tickt eine Uhr. Im Tamagotchi läuft sie
erstmals synchron zur Lebenszeit des Spielers. Zwischen morgens neun und
abends zehn ist der Zögling wach und verlangt immer wieder piepsend
Aufmerksamkeit und Pflege. Resultat des Erziehungsspiels ist entweder ein
fröhliches, gesundes, langlebiges Tamagotchi oder ein egoistisches,
übergewichtiges, kränkelndes. Die wichtigste Lektion dieses Erziehungsspiels:
Die Lebenszeit der Kreatur - bei guter Behandlung bis zu dreißig
Tage - läuft unaufhaltsam ab und endet mit dem Tod. Das Tamagotchi
hat eine ambivalente Zwischenexistenz zwischen Organismus und Artefakt.
Wie die Erfahrung der Sterblichkeit bei jedem anderen Haustier ist die
des Tamas für die Kinder dramatisch, wovon die Friedhöfe
im Internet Kunde tun. Wie jede andere Existenz aus Silikon und Code lehrt
auch das Tama sie, daß es immer einen Neustart gibt.
In
allen elektronischen Spielen tickt eine Uhr. Im Tamagotchi läuft sie
erstmals synchron zur Lebenszeit des Spielers. Zwischen morgens neun und
abends zehn ist der Zögling wach und verlangt immer wieder piepsend
Aufmerksamkeit und Pflege. Resultat des Erziehungsspiels ist entweder ein
fröhliches, gesundes, langlebiges Tamagotchi oder ein egoistisches,
übergewichtiges, kränkelndes. Die wichtigste Lektion dieses Erziehungsspiels:
Die Lebenszeit der Kreatur - bei guter Behandlung bis zu dreißig
Tage - läuft unaufhaltsam ab und endet mit dem Tod. Das Tamagotchi
hat eine ambivalente Zwischenexistenz zwischen Organismus und Artefakt.
Wie die Erfahrung der Sterblichkeit bei jedem anderen Haustier ist die
des Tamas für die Kinder dramatisch, wovon die Friedhöfe
im Internet Kunde tun. Wie jede andere Existenz aus Silikon und Code lehrt
auch das Tama sie, daß es immer einen Neustart gibt.  Der Erfolg des Tamagotchi übertraf alle Erwartungen. Im ersten halben
Jahr wurden in Japan fünfzehn Millionen Stück verkauft. Lieferengpässe
heizten seinen Kultstatus weiter an. Versionen für PC, Gameboy und
als Java-Script fürs Internet tauchten auf, sowie Kopien, in denen
sich Hunde, Katzen und Dinosaurier- oder Menschen-Babies tummeln. Einer
jüngsten Statistik zufolge gibt es bereits mehr virtuelle Haustiere
in Japan als solche aus Fleisch und Blut. Es folgten die üblichen
Fan-Artikel wie Stofftiere, Federmappen, Socken, gar ein PHS-Telefon (Personal
Handy-Phone System) mit einem Tamagotchi auf dem Display, das mit Artgenossen
in anderen Telefonen spielt. Daß es bei der Markteinführung
in Hongkong, Südkorea, den USA und Europa zu ähnlichen Boom-Erscheinungen
kam, zeigt die uneingeschränkte Universalisierbarkeit des popularkulturellen
Imaginären Japans.
Der Erfolg des Tamagotchi übertraf alle Erwartungen. Im ersten halben
Jahr wurden in Japan fünfzehn Millionen Stück verkauft. Lieferengpässe
heizten seinen Kultstatus weiter an. Versionen für PC, Gameboy und
als Java-Script fürs Internet tauchten auf, sowie Kopien, in denen
sich Hunde, Katzen und Dinosaurier- oder Menschen-Babies tummeln. Einer
jüngsten Statistik zufolge gibt es bereits mehr virtuelle Haustiere
in Japan als solche aus Fleisch und Blut. Es folgten die üblichen
Fan-Artikel wie Stofftiere, Federmappen, Socken, gar ein PHS-Telefon (Personal
Handy-Phone System) mit einem Tamagotchi auf dem Display, das mit Artgenossen
in anderen Telefonen spielt. Daß es bei der Markteinführung
in Hongkong, Südkorea, den USA und Europa zu ähnlichen Boom-Erscheinungen
kam, zeigt die uneingeschränkte Universalisierbarkeit des popularkulturellen
Imaginären Japans.
Inzwischen beginnt die Evolution in silicio eine nachgerade kambrische
Artenvielfalt hervorzubringen. Während Bandai und seine Imitatoren
immer neue Varianten von Tamagotchi nachschieben, setzte Fujitsu mit "Fin
Fin" einen niedlichen  Delphin-Vogel
ins Nest des PC. Das scheue Wesen vom Zauberplaneten Teo gewinnt mit etwas
Geduld Zutrauen zu seinem menschlichen Freund. Dieser kann sich mit Hilfe
einer Teo-Pfeife über Mikrophon mit ihm verständigen. Fin Fin
bemerkt es, wenn man ins Zimmer kommt, begrüßt einen und schaut
neugierig zu, was man sonst so am Computer tut. Fin Fin ist kein Game,
sondern ein Begleiter, mit dem man die ohnehin zunehmende Zeit am Computer
gemeinsam verbringt.
Delphin-Vogel
ins Nest des PC. Das scheue Wesen vom Zauberplaneten Teo gewinnt mit etwas
Geduld Zutrauen zu seinem menschlichen Freund. Dieser kann sich mit Hilfe
einer Teo-Pfeife über Mikrophon mit ihm verständigen. Fin Fin
bemerkt es, wenn man ins Zimmer kommt, begrüßt einen und schaut
neugierig zu, was man sonst so am Computer tut. Fin Fin ist kein Game,
sondern ein Begleiter, mit dem man die ohnehin zunehmende Zeit am Computer
gemeinsam verbringt.
Kurz nachdem die Tamagotchi-Welle Europa erreichte, folgte das PC-Spiel
"Creatures" (Millenium). Die Wesen mit großen Kulleraugen und spitzen
Ohren, die hier aus dem Ei schlüpfen, heißen Norns und leben
in der Zuckerbäckerwelt namens Albia. Der Spieler befindet sich in
der Rolle eines Zoowärters, kann seine Zöglinge mit dem in eine
Hand verwandelten Mauszeiger streicheln oder bestrafen, ihnen Sprechen
beibringen und muß sie verarzten, wenn sie giftige Pilze gegessen
haben. Umfangreiche Eigenschaftslisten und eine gewisse Lernfähigkeit
sorgen dafür, daß jeder Norn seine eigene Persönlichkeit  entwickelt.
Ihr Aufseher kann sie dazu bringen, sich zu paaren, und besonders wohlgeratene
Exemplare zu Zuchtzwecken im Netz an Freunde verschicken. Genmanipulation
für Sechsjährige ist jetzt einfacher als Kuchenbacken.
entwickelt.
Ihr Aufseher kann sie dazu bringen, sich zu paaren, und besonders wohlgeratene
Exemplare zu Zuchtzwecken im Netz an Freunde verschicken. Genmanipulation
für Sechsjährige ist jetzt einfacher als Kuchenbacken.
Die Verniedlichung der Lebenswelt macht auch vor etwas so Funktionalem wie Email nicht halt. Das neuste Projekt des Kommunikationskünstlers Hachiya Kazuhiko sind die "Post Pets". Bären und Katzen tragen die elektronischen Briefe ihres Herrchen aus, allerdings nur einen einzigen pro Tag. Gelegentlich schicken sie auch eigene Botschaften an ihre Artgenossen oder bleiben länger aus, um mit anderen Posttierchen zu spielen. Auch sie sterben und gehen in das Pet-Paradies im Internet ein, wo ihre ehemaligen Besitzer ihnen beim Spielen zuschauen können.
Regel und Zufall kleiden sich beim sodate geemu in die Eigenwilligkeit und vermeintliche Autonomie eines elektronischen, animierten Wesens. Der Konflikt besteht darin, es durch verschiedene Entwicklungsstadien zu führen. Die Faktoren bei der Bestimmung der Spielzüge sind mehrschichtiger als die einer binären Alternative von Gewinnen oder Verlieren. Die Motivlage beim Spielen ist natürlich immer komplex. In diesem Fall gehört sicher das Gefühl dazu, sich in der kontrollierten Gesellschaft Japans mit ihren vorgeschriebenen Entwicklungsbahnen zu bewegen, das das Bedürfnis schürt, in einer eigenen 'Welt am Draht' die Fäden in der Hand zu halten. Indem er ein wenn auch sehr reduziertes Repertoire von Belohnung und Bestrafung handhabt, kann der Spieler selber Macht und Verantwortung tragen.
So formuliert werden Erziehungsspiele als eine Parodie von Partizipation
und als ein massenkulturindustrieller Ausdruck dessen verständlich,
was Informatiker und Biologen in Nachfolge Turings unter dem Titel "Artificial
Life" verhandeln. Forscher wie Thomas Ray, der am Advanced Telecommunications
Research Lab in Kansai Science City seine digitalen Ökotope ins Internet
stellt, sprechen von einer Biologie des Möglichen [vgl. z.B. Emmeche
1994, Lewin 1996]. Auch wenn Princess und Tamagotchi weit entfernt sind
von den intrikaten Modellen genetischer Algorithmen und selbstorganisierender
neuronaler Netze, so lehren sie die Spieler mit jeder Runde, die Welt der
Artefakte als virtuell belebt zu denken. Eine weitere Vorhersage Turings
scheint sich zu bestätigen, nämlich "daß am Ende unseres
Jahrhunderts der Sprachgebrauch und die allgemeine Meinung sich so stark
gewandelt haben werden, daß man widerspruchslos von denkenden Maschinen
reden kann." [1987: 160] Und, wird man hinzufügen müssen, von
lebenden.
Techno-Orientalismus
Mario und Sonic the Hedgehog sind Weltenbürger, und zugleich sind
sie unverkennbar japanische Staatsangehörige. Ist die US-amerikanische
Nationalidentität auf Mikroprozessoren, Hollywood-Filme und Software
gebaut, so die japanische auf Memory-Chips, Games und Japanimation. Für
die These, das Projekt Technologie als identitätsstiftender Kern der
Moderne sei von Europa über Amerika nach Japan abgewandert,  haben
Moreley und Robins den Begriff des Techno-Orientalismus(4)
eingeführt. "Japan ist synonym geworden mit den Technologien der Zukunft
- mit Bildschirmen, Netzwerken, Kybernetik, Robotik, künstlicher Intelligenz,
Simulation... Wenn die Zukunft technologisch ist, und wenn Technologie
'japanisiert' wurde, dann suggerierte der Syllogismus, daß auch die
Zukunft jetzt japanisch sei." [1995: 168] Das Motiv findet sich in wirtschaftlichen
und politischen Diskursen ebenso wie im Science-Fiction von Ridley Scotts
"Blade Runner" (1982) oder William Gibsons Cyberpunk-Romanen. Der Westen
bilde sich eine Techno-Mythologie, derzufolge Japan die Welt in eine Art
"postmoderne Mutation der menschlichen Erfahrung" führen werde, ein
Reich gänzlich anderer elektronischer Zeichen, Bilder und Klänge,
wie sie uns im technologischen Format von Karaoke, Computer-Games und Virtual
Reality entgegentreten.
haben
Moreley und Robins den Begriff des Techno-Orientalismus(4)
eingeführt. "Japan ist synonym geworden mit den Technologien der Zukunft
- mit Bildschirmen, Netzwerken, Kybernetik, Robotik, künstlicher Intelligenz,
Simulation... Wenn die Zukunft technologisch ist, und wenn Technologie
'japanisiert' wurde, dann suggerierte der Syllogismus, daß auch die
Zukunft jetzt japanisch sei." [1995: 168] Das Motiv findet sich in wirtschaftlichen
und politischen Diskursen ebenso wie im Science-Fiction von Ridley Scotts
"Blade Runner" (1982) oder William Gibsons Cyberpunk-Romanen. Der Westen
bilde sich eine Techno-Mythologie, derzufolge Japan die Welt in eine Art
"postmoderne Mutation der menschlichen Erfahrung" führen werde, ein
Reich gänzlich anderer elektronischer Zeichen, Bilder und Klänge,
wie sie uns im technologischen Format von Karaoke, Computer-Games und Virtual
Reality entgegentreten.
Die westliche Konstruktion einer techno-orientalistischen Differenz zu sich selbst hat ihr komplizenhaftes Pendant in der japanischen Selbst- und Fremdreflexion. Japans staatstragende Denkelite heftet sich einerseits den Erfolg von Anime und Games im asiatischen und westlichen Ausland an die Brust. Anderseits sorgt sie sich um die geistige und moralische Gesundheit der Jugend von heute.
Anerkennung erteilte der Westen dem Nachkriegs-Japan zunächst für Fleiß, Sparsamkeit, technologische Präzision und schließlich für die gesamtwirtschaftliche Leistung, die Ezra Vogel 1979 mit olympischem Gold prämiert. Japan ist Number One. 1980 läutete dann Ministerpräsident Ôhira das Ende von Ökonomismus und Materialismus und den Beginn des "Zeitalters der Kultur" ein. Miyazawa stellte die Neunziger unter das Motto "Lifestyle Superpower" (Seikatsu Taikoku). Diese Lebensqualität wird zwar weiterhin technologisch operationalisiert als mehr Kommunikation und mehr Medien. Die Rede von der sozialen Infrastruktur übersetzt sich reibungslos in die Pläne fürs Internet und für ein Breitband-ISDN in jeden Haushalt bis 2010. Doch fehlt dabei etwas schwer zu Planendes, etwas das mit 'Kreativität' und 'Originalität' benannt wird, um die neuen Schläuche mit neuem Wein zu füllen. Obgleich die Vision der Informationsgesellschaft seit den sechziger Jahren die Umwandlung Japans in eine "Soft Society" (Hayashi Yûjirô) vorsah, wird ihm eine anhaltende Schwäche im Bereich von Computer-Software attestiert. Japan leidet darunter, keine Programmiersprache und kein Betriebssystem hervorgebracht zu haben, die sich international durchsetzen konnten. Nur eingebettete Software in Konsum- und Industrieprodukten hat eine Präsenz auf den Exportmärkten, und eben Videogames [vgl. Cusumano 1991: S.44].
 Imai
Kenichi sieht heute eine Verschiebung der industriellen Struktur Japans
von Hardware zu Software und von der herstellenden Industrie zu Dienstleistungen.
"Die Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten eines jeden Landes spiegeln
die technologischen Bedingungen der Zeit wieder, in der sie sich entwickelt
haben. Im Falle Japans ist es daher natürlich, daß elektronische
Formen der Unterhaltung - Pachinko, Karaoke und Videogames - die Führung
übernommen haben." Im westlichen Eingeständnis der komparativen
Stärken seines Landes in diesem Bereich erkennt Imai einen ersten
Schritt zu einem neuen nationalen Selbst-Bewußtsein [Imai 1996].
"Die Informationstechnologien werden von den jüngeren Japanern dominiert
werden, die bereits demonstriert haben, daß sie in solchen Bereichen
wie Videogames und Animationsfilmen in die Weltspitze aufsteigen können."
[Imai 1997] Nintendo ist Japans Microsoft. Japanimation wie "Akira" und
"Mononoke-hime", das im Wettbewerb der Berlinale 1998 lief, zeigen, daß
kultureller Content aus der aktuellen japanischen Jugendkultur global anschlußfähig
ist. Japan ist stolz auf seine Otaku.
Imai
Kenichi sieht heute eine Verschiebung der industriellen Struktur Japans
von Hardware zu Software und von der herstellenden Industrie zu Dienstleistungen.
"Die Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten eines jeden Landes spiegeln
die technologischen Bedingungen der Zeit wieder, in der sie sich entwickelt
haben. Im Falle Japans ist es daher natürlich, daß elektronische
Formen der Unterhaltung - Pachinko, Karaoke und Videogames - die Führung
übernommen haben." Im westlichen Eingeständnis der komparativen
Stärken seines Landes in diesem Bereich erkennt Imai einen ersten
Schritt zu einem neuen nationalen Selbst-Bewußtsein [Imai 1996].
"Die Informationstechnologien werden von den jüngeren Japanern dominiert
werden, die bereits demonstriert haben, daß sie in solchen Bereichen
wie Videogames und Animationsfilmen in die Weltspitze aufsteigen können."
[Imai 1997] Nintendo ist Japans Microsoft. Japanimation wie "Akira" und
"Mononoke-hime", das im Wettbewerb der Berlinale 1998 lief, zeigen, daß
kultureller Content aus der aktuellen japanischen Jugendkultur global anschlußfähig
ist. Japan ist stolz auf seine Otaku.
Andererseits häufen sich kritische Töne. Sozialwissenschaftler
und Kulturkritiker sagen das, was sie bei jeder neuen Mediengeneration
sagen: Games seien ein gefährlicher, mindestens jedoch ein nutzloser
Zeitvertreib, der Jugendliche von der höherwertigen Kulturtechnik
des Bücherlesens abhalte. Bedenklich sind die Fälle von Videogame-
und Anime-induzierter Epilepsie wie der jüngste, bei dem 800 Kinder
durch Stroboskop-Effekte in der Fernsehserie "Pocket Monster" geschädigt
ins Krankenhaus gebracht werden mußten.  Ein
vollständiger Wirklichkeitsverlust durch exzessiven Gebrauch von Medien
wird unterstellt, wenn Jugendliche morden. Als 1989 die Leichen von vier
Mädchen gefunden wurden, war mit der Formel, der Täter sei ein
"Video-Otaku", vermeintlich alles erklärt. Als im Mai 1997 der Kopf
eines Grundschülers vor dem Tor einer Schule in Kobe gefunden wurde,
schlossen alle Beobachter aus anonymen Briefen des Täters auf einen
kaltblütigen Killer, der Vergnügen daran findet mit dem Leben
von Menschen zu spielen. Der Schock war groß als sich zwei Monate
später herausstellte, daß es ein 14-Jähriger war. Schuld
wurde den trostlosen Wohnblocks des Vororts gegeben, in dem er wohnte,
der Schule, an der er Rache üben wollte, und der mediengesättigten
Umwelt. In der folgenden Nabelschau stellte die japanische Gesellschaft
eine tiefgreifende moralische Verunsicherung an sich fest. Politikwissenschaftler
Masuzoe Yôichi [1997]: "Wir haben eine Generation herangezogen, die
sich nichts dabei denkt zu töten. Jetzt sehen wir die schockierenden
Folgen." Zwar halte die Untersuchung noch an, doch ein Schuldiger
steht für Masuzoe bereits fest: Virtual Reality. Zum Beleg führt
er Stellen aus den Briefen des Täters an, die ihn als "charakteristisch
für die Generation, die mit elektronischen Spielen aufgewachsen ist,"
erkennbar machen. Mit Kriegsspielen, in denen es Blut, Schmerz, Leiden
und Tod nicht gibt und die die Erfahrung einer magischen Omnipotenz erzeugen.
Als einziges Gegengift gegen die zersetzende Wirkung der Virtualität
empfiehlt er 'Aktualität'. Eltern und Schule sollten dafür sorgen,
daß die Zeit für Fernsehen und Games beschränkt und das
Lesen der Weltliteratur, Sport, der Umgang mit der Natur und vor allem
mit Menschen aus Fleisch und Blut ermuntert wird. Doi Takeo ist der Ansicht,
daß der Junge durch die Erziehung zu emotionaler Unabhängigkeit
sein amae nur auf perverse Weise ausleben konnte und empfiehlt harte
Strafen. Auch Forderungen nach Zensur der Game- und der Medien-Inhalte
allgemein werden laut.
Ein
vollständiger Wirklichkeitsverlust durch exzessiven Gebrauch von Medien
wird unterstellt, wenn Jugendliche morden. Als 1989 die Leichen von vier
Mädchen gefunden wurden, war mit der Formel, der Täter sei ein
"Video-Otaku", vermeintlich alles erklärt. Als im Mai 1997 der Kopf
eines Grundschülers vor dem Tor einer Schule in Kobe gefunden wurde,
schlossen alle Beobachter aus anonymen Briefen des Täters auf einen
kaltblütigen Killer, der Vergnügen daran findet mit dem Leben
von Menschen zu spielen. Der Schock war groß als sich zwei Monate
später herausstellte, daß es ein 14-Jähriger war. Schuld
wurde den trostlosen Wohnblocks des Vororts gegeben, in dem er wohnte,
der Schule, an der er Rache üben wollte, und der mediengesättigten
Umwelt. In der folgenden Nabelschau stellte die japanische Gesellschaft
eine tiefgreifende moralische Verunsicherung an sich fest. Politikwissenschaftler
Masuzoe Yôichi [1997]: "Wir haben eine Generation herangezogen, die
sich nichts dabei denkt zu töten. Jetzt sehen wir die schockierenden
Folgen." Zwar halte die Untersuchung noch an, doch ein Schuldiger
steht für Masuzoe bereits fest: Virtual Reality. Zum Beleg führt
er Stellen aus den Briefen des Täters an, die ihn als "charakteristisch
für die Generation, die mit elektronischen Spielen aufgewachsen ist,"
erkennbar machen. Mit Kriegsspielen, in denen es Blut, Schmerz, Leiden
und Tod nicht gibt und die die Erfahrung einer magischen Omnipotenz erzeugen.
Als einziges Gegengift gegen die zersetzende Wirkung der Virtualität
empfiehlt er 'Aktualität'. Eltern und Schule sollten dafür sorgen,
daß die Zeit für Fernsehen und Games beschränkt und das
Lesen der Weltliteratur, Sport, der Umgang mit der Natur und vor allem
mit Menschen aus Fleisch und Blut ermuntert wird. Doi Takeo ist der Ansicht,
daß der Junge durch die Erziehung zu emotionaler Unabhängigkeit
sein amae nur auf perverse Weise ausleben konnte und empfiehlt harte
Strafen. Auch Forderungen nach Zensur der Game- und der Medien-Inhalte
allgemein werden laut.
Während auf diese Weise das offizielle Japan die Früchte des internationale Erfolgs zu ernten und die 'Nebenwirkungen' zu kontrollieren sucht, stellt sich das Phänomen aus dem Blick der Jugendszenen, die es hervorbringen, naturgemäß etwas anders dar. Die visuelle und soziale Kultur der Games ist eng verwandt mit der der Manga und Anime. Sie verfügen über einen kommerziellen Mainstream und über einen Underground, aus dem sich jener immer wieder auffrischt und nährt, und sie feiern sich in ihren Helden und Königen. In einer Businesskultur wie der japanischen, in der individueller Ausdruck, Risikobereitschaft, Verspieltheit und Exzentrik verpönt sind, nehmen die "Creators" einen besonderen Freiraum für sich in Anspruch. In den Siebzigern waren solche medialen Stars vor allem Mode- und Grafik-Designer. In den Achtzigern waren es die Werbetexter und Event-Planer. In den Neunzigern stehen die Game-Designer und Anime-ka im Rampenlicht.
Einer der größten Medienkultur-Stars der 80er Jahre, Itoi Shigesato, verkörperte den Idealtyp des Shinjinrui ("Neue Menschheit" oder "Neue Generation"), ein Image von Jetset, Yuppietum und Kreativität. Er wurde mit seiner Werbung für die Kaufhauskette Seibu berühmt. Slogans wie "fushigi daisuki" ("Ich liebe das Mysteriöse") oder "oishii seikatsu" ("köstliches Leben") brachten ihm Vergleiche mit den Meistern des Haiku ein. Er betätigte sich außerdem als Event-Planer, hatte seine eigene TV-Show und gab gar eine Tageszeitung heraus. Auch mit seinem Adventure-Game "Mother" für den Famicon traf er die Meta-Massen-Sensibilität der Zeit. Die Figur des Spielers heißt Ninten und ist zusammen mit drei Freunden unterwegs in ein geheimnisvolles Land, das erkennbar nach den USA modelliert ist. Hintergrund ist eine New Age-Philosophie von Mutter Erde und der Herausforderung, die Probleme in einem selbst zu lösen. In der von Itoi herausgegebenen "Mother Encyclopedia" (1989) schrieben andere Media-Creators wie Itô Seiko und akademische Intellektuelle wie Nakazawa Shinichi über ihre Erfahrungen und Gefühlsregungen beim Spielen von "Mother". Das Buch hob das Genre der Game-Kritik auf ein neues Niveau und verlieh der Spielerei ein weiteres Stück Glanz der Hochkultur [vgl TGM 1994: 126 f.].
Parallel dazu betritt mit den otaku ein neuer Stamm (zoku)
das Spielfeld. Diese Generation amaeru-t nicht mehr mit Mutter Gaia
sondern mit Mutter Computer. Die Medien-Monade schließt sich. Aus
dem Rückkopplungskreis von Game-Konsole und Fernseher ist der exklusive
Terminal zur Welt geworden. Asada Akira diagnostiziert eine  Verschiebung
in der Imagination des Science Fiction von der paternalistischen Dystopie
eines Big Brother, z.B. in Orwells "1984", hin zur maternalen umhegenden
Figur eins 'Mutter-Computers', der ein 'Mutter-Schiff' oder eine 'Mutter-Stadt'
kontrolliert. An den Videogames zeige sich eine Infantilisierung durch
eine Art von elektronischem Mutterschoß [Grassmuck 1990].
Verschiebung
in der Imagination des Science Fiction von der paternalistischen Dystopie
eines Big Brother, z.B. in Orwells "1984", hin zur maternalen umhegenden
Figur eins 'Mutter-Computers', der ein 'Mutter-Schiff' oder eine 'Mutter-Stadt'
kontrolliert. An den Videogames zeige sich eine Infantilisierung durch
eine Art von elektronischem Mutterschoß [Grassmuck 1990].
Daß daraus die Otaku geboren werden, entdeckte als erster 1984 Nakamori Akio. Die Otaku sind bis heute wesentlich eine 'Subkultur', die ihre Infrastruktur in den Zirkeln der dôjinshi, der Manga von Fans für Fans im Eigenverlag, den regelmäßigen komike (Comic-Markt) und anderen Events, und schließlich in den elektronischen Mailboxen hat [vgl. Grassmuck 1993]. Aber, "das Problem mit den Otaku ist nicht, daß sie ein Underground wären, vielmehr sind sie ein weitverbreitetes Phänomen und gleichzeitig vollständig geschlossen, 'anti-sozial' und isoliert. Ihre Zahl ist sehr groß..." [Azuma in Woznicki 1998] Während die Shinjinrui die Warenästhetik der herrschenden Konsumkultur zum Kult erhoben hatten, sind die Otaku im wesentlichen anti-professionell. Sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Szene der Lohnarbeit, auch wenn durch ihre Hobbyaktivitäten erhebliche Beträge in ihren Schwarzmarktnetzen zirkulieren. Doch auch hier gibt es Helden und Könige, die aus dem Underground heraus zur Berühmtheit aufgestiegen sind.
Z.B. Taku Hachirô, der als selbsternanntes Sprachrohr der Otaku in der Illustrierten Spâ! und in Fernsehshows einer breiteren Öffentlichkeit davon berichtete, was mit ihren Kindern vor sich geht. Er tat dies nicht als distanzierter Sozialpsychologe, sondern inszenierte ein 'authentisches' Otaku-tum auf massenmedien-gerechte Weise.
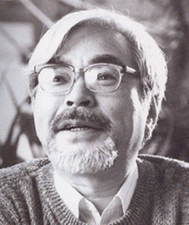 Zu
den wichtigsten Stars der Szene gehören die Anime-Regisseure, allen
voran Miyazaki Hayao. Sein erster abendfüllender Film "Lupin III.:
Das Schloß von Cagliostro" (1979) etablierte den Otaku-Bildkanon
von mechas ("mechanical gadgets": Roboter, Cyborgs, Fahrzeuge und
Kampfmaschinen, hydraulische Schutzpanzer) und Mädchen (langbeinige,
vollbusige, Bambi-äugige Girls mit kurzen Röcken, unter denen
gelegentlich das Höschen sichtbar ist). Die Heldin aus "Lupin" war
das erste Otaku-Idoru und eine beliebte Vorlage für die parodistischen
Kopien in den dôjinshi-Manga. Mit Filmen wie "Nausikaa" (1984)
und "Majo no Takkyûbin" (1989) verließ Miyazaki den geschlossenen
Kreis der Otaku-Welt und errang sich den Namen eines "Walt Disney von Japan".
Tatsächlich spielten "Mimi o Sumaseba" (1995) und "Mononoke-hime"
(1997) in den japanischen Kinos mehr ein, als die jeweiligen Disney-Animationen
der Saison.
Zu
den wichtigsten Stars der Szene gehören die Anime-Regisseure, allen
voran Miyazaki Hayao. Sein erster abendfüllender Film "Lupin III.:
Das Schloß von Cagliostro" (1979) etablierte den Otaku-Bildkanon
von mechas ("mechanical gadgets": Roboter, Cyborgs, Fahrzeuge und
Kampfmaschinen, hydraulische Schutzpanzer) und Mädchen (langbeinige,
vollbusige, Bambi-äugige Girls mit kurzen Röcken, unter denen
gelegentlich das Höschen sichtbar ist). Die Heldin aus "Lupin" war
das erste Otaku-Idoru und eine beliebte Vorlage für die parodistischen
Kopien in den dôjinshi-Manga. Mit Filmen wie "Nausikaa" (1984)
und "Majo no Takkyûbin" (1989) verließ Miyazaki den geschlossenen
Kreis der Otaku-Welt und errang sich den Namen eines "Walt Disney von Japan".
Tatsächlich spielten "Mimi o Sumaseba" (1995) und "Mononoke-hime"
(1997) in den japanischen Kinos mehr ein, als die jeweiligen Disney-Animationen
der Saison.

Die Creators der Neunziger betätigen sich wie ihre Vorgänger als Brückenbauer zwischen den Otaku-Zirkeln und anderen Szenen. So schuf der Medienkünstler Iwai Toshio Game-inspirierte Installationen wie die "Music Insects" und erlangte mit
der populärwissenschaftlichen Fernsehshow "Einstein TV" (1990-91) und der täglichen Kindersendung "UgoUgo Lhuga" (1992-94) Kultstatus. Für die Sendungen entwickelte er auf dem Amiga virtuelle Sets und Echtzeit-animierte Computergraphikfiguren, mit denen die Schauspieler wie in einem Game oder einem Live-Anime interagierten.
Ein Vermittler zwischen der DJ-Kultur und der von Videospielen ist Satô Dai, der nicht nur selbst auflegt und sich als Game-Journalist engagiert, sondern auch den "Super Mario Rap" mit der Londoner Gruppe Ambassadors of Funk produzierte und den "Game-Rave" erfand, eine neue Kategorie von Event, bei dem reichlich Video-Konsolen in einem Club aufgestellt werden [vgl. TGM 1994: 108].
Der Hypermedia-Creator Takashiro Tsuyoshi liebt es, sich als neuer Typ von kreativem, jungem und geschäftstüchtigem Geist zu inszenieren. Ein Paradiesvogel, wie in einem ständigen kosu purei (costume play), der medial zurückgebliebenen, krawattentragenden Geschäftsleuten erklärt, was Multimedia und Internet nun wirklich bedeuten. Takashiro hat Werbe- und Video-Clips, TV-Dramas und das techno-psychedelische "Video-Drug" produziert. Seine Bildästhetik wird weniger durch das heimische Otaku-Genre als durch die Kultur am zweiten Standort seiner Firma "Future Pirates", nämlich Los Angeles beeinflußt. Für sein CD-ROM-Game "Whacky Races" verwendet er die amerikanischen Cartoon-Figuren von Hanna-Barbera. 1995 eröffnete er eine Internet-Shopping-Mall namens "Franky Online". Darin sieht das globale Datennetz aus wie ein interaktives Anime, wie ein dreidimensionales Computer-Game, bei dem man ganz spielerisch bei einer Pferdefigur in der "Einwanderungsbehörde" seine Kreditkartennummer hinterlegt.
Ursprung und Kern der Otaku-Kultur bleiben Manga und Anime. Eine der wichtigsten Institutionen auf diesem Feld ist das Anime- und Game-Produktionsstudio Gainax. Es entstand Anfang der Achtziger aus einer Amateurgruppe, die die Eröffnungsfilme für die "Osaka Si-Fi Convention" schuf. Die Gruppe gründete dann zusammen mit dem Producer der "Convention", Okada Toshio, die Firma Gainax. Mit Anime wie "Honneamise" (1987) und Anno Hideakis "Evangelion" (1995), dem Entwicklungsspiel "Princess Maker" und dem Mockumetary "Otaku no Video" (1991) gelang es Gainax immer wieder, die Bewegungen innerhalb der Otaku-Szene zu erfassen und sie ihr zurückzuspiegeln.
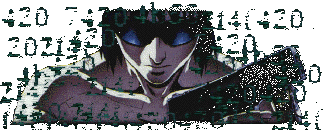
Über der Otaku-Welt hängt eine paranoische Grundstimmung von
Isolation, Gehirnwäsche und einer marionettenhaften Existenz. In "Ghost
in the Shell" (1996) von Oshii Mamoru, einem früheren Hardcore-Otaku
Anime-ka und Fan von Shuji Terayama, wimmelt es nur so von Cyborgs,  die
nur noch zu einem Bruchteil aus menschlicher, biologischer Materie bestehen.
Im Zentrum der Geschichte steht der "Puppen-Meister", eine Intelligenz,
die aus dem Netz emergiert ist und jetzt als Hacker die "Geister" der Menschen
manipuliert und ihre Erinnerungen umprogrammiert. Wer die Bilder von den
Aum-Anhängern mit ihren Elektrodennetzen auf dem Kopf gesehen hat,
wird unweigerlich daran denken.
die
nur noch zu einem Bruchteil aus menschlicher, biologischer Materie bestehen.
Im Zentrum der Geschichte steht der "Puppen-Meister", eine Intelligenz,
die aus dem Netz emergiert ist und jetzt als Hacker die "Geister" der Menschen
manipuliert und ihre Erinnerungen umprogrammiert. Wer die Bilder von den
Aum-Anhängern mit ihren Elektrodennetzen auf dem Kopf gesehen hat,
wird unweigerlich daran denken.
Anno Hideakis "Evangelion" erschien ein halbes Jahr nach dem Sarin-Anschlag der Aum-Shinrikyô. Der Plot hatte so große Ähnlichkeit mit den Vorfällen um die Sekte, daß Anno ihn nach eigenem Bekunden ändern mußte, um nicht seinen fiktionalen Charakter zu verlieren. An Aum beobachteten Japans Kulturkritiker, was passiert, wenn eine Gruppe sich so weit in ihre Geschlossenheit und Exklusivität steigert, daß sie den Kontakt mit der Wirklichkeit verliert und nur noch in einer kollektiven paranoischen Fiktion lebt. Das gleiche Symptom von Abgeschlossenheit in einer medialen Selbstreferenz wird den Otaku-Mördern individuell attestiert. Noch weiter gesteckt benennt es auch die Selbst- und Außenbeobachtung Japans als geschlossenes Otaku-System gegenüber der Welt.
 "Evangelion"
bedient Otaku-Cliches mit Mechas und Mädchen, mit Parodien und Zitaten
aus der Geschichte des Genres bis zu zurück zu "Space Battleship Yamato"
(1974).(5) Zugleich kritisiert Anno darin
die Geschlossenheit der Otaku-Zirkel selbst. Immer kleinere Interessenbereiche
differenzieren sich aus und grenzen sich gegeneinander ab. Mit den eigenständigen
Distributionswegen für dôjinshi und dem OVA-System (Original
Video Animation) gelang es, eine Parallelwelt zur offiziellen Kultur zu
errichten, einen Massenmarkt, in dem die Otaku ohne Rücksichten auf
Mainstream-Geschmäcker in ihrer Selbstbezüglichkeit weiterkreisen
können. Mit seiner Figur der "Rei" (= Null) führt Anno eine neue
Form der Einsamkeit jenseits von Otaku ein [Woznicki, 1998].
"Evangelion"
bedient Otaku-Cliches mit Mechas und Mädchen, mit Parodien und Zitaten
aus der Geschichte des Genres bis zu zurück zu "Space Battleship Yamato"
(1974).(5) Zugleich kritisiert Anno darin
die Geschlossenheit der Otaku-Zirkel selbst. Immer kleinere Interessenbereiche
differenzieren sich aus und grenzen sich gegeneinander ab. Mit den eigenständigen
Distributionswegen für dôjinshi und dem OVA-System (Original
Video Animation) gelang es, eine Parallelwelt zur offiziellen Kultur zu
errichten, einen Massenmarkt, in dem die Otaku ohne Rücksichten auf
Mainstream-Geschmäcker in ihrer Selbstbezüglichkeit weiterkreisen
können. Mit seiner Figur der "Rei" (= Null) führt Anno eine neue
Form der Einsamkeit jenseits von Otaku ein [Woznicki, 1998].
Es scheint, als gelänge es den Otaku dem Gefängnis namens
Gesellschaft zu entkommen, nur um sich in der technologischer Medialität
und Selbstreferenz ein neues Gehäuse zu bauen. Auch Okada Toshio sieht
in der Schließung das Hauptproblem, wie er in seinem Buch "Unsere
Gehirnwäsche-Gesellschaft" (Bokutachi no sennô shakai,
Asahi Shimbunsha, 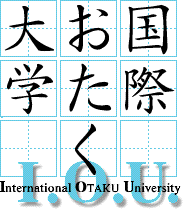 Tokyo
1995) schreibt. Als Mitbegründer von Gainax, war Okada ebenso wie
Anno beteiligt an der Produktion von "Honneamise", an der NHK Anime-Serie
"Fushigi no Umi no Nadia" (Nadia of the Mysterious Seas) (1990) und des
PC-Games "Princess Maker". Nachdem er Gainax aufgrund von Meinungsverschiedenheiten
verlassen hat, kehrte der selbsternannte "Otaking" an seine Alma Mater,
die Tokyo Universität, zurück, um äußerst populäre
Seminare über den 'Otakismus' zu halten. Er veröffentlichte eine
"Einführung in die Otaku-Forschung" [otaku gaku nyumon, Ohta
Verlag, Tokyo 1996], rief eine "Internationale
Otaku-Universität" ins Leben, um online den Otakismus in aller
Welt zu fördern, und plant, einen Otaku-Fernsehkanal zu starten. Damit
hätte der Otakismus nicht nur aus den heiligsten akademischen Hallen
Japans die Würde eines Ideengebäudes, eines -ismus, erlangt,
sondern auch noch einen breitbandigen 24-Stunden-Rückkopplungskanal.
Tokyo
1995) schreibt. Als Mitbegründer von Gainax, war Okada ebenso wie
Anno beteiligt an der Produktion von "Honneamise", an der NHK Anime-Serie
"Fushigi no Umi no Nadia" (Nadia of the Mysterious Seas) (1990) und des
PC-Games "Princess Maker". Nachdem er Gainax aufgrund von Meinungsverschiedenheiten
verlassen hat, kehrte der selbsternannte "Otaking" an seine Alma Mater,
die Tokyo Universität, zurück, um äußerst populäre
Seminare über den 'Otakismus' zu halten. Er veröffentlichte eine
"Einführung in die Otaku-Forschung" [otaku gaku nyumon, Ohta
Verlag, Tokyo 1996], rief eine "Internationale
Otaku-Universität" ins Leben, um online den Otakismus in aller
Welt zu fördern, und plant, einen Otaku-Fernsehkanal zu starten. Damit
hätte der Otakismus nicht nur aus den heiligsten akademischen Hallen
Japans die Würde eines Ideengebäudes, eines -ismus, erlangt,
sondern auch noch einen breitbandigen 24-Stunden-Rückkopplungskanal.
Der Grundtendenz der Otaku - und Japans - zur Bildung von operativ geschlossenen Systemen korrespondiert also die Funktion einer grenzüberschreitenden Vermittlung. Leute wie Okada oder Anno operieren in mindestens zwei Systemen. Sie übersetzen und erzeugen Anschlußfähigkeiten. Sie sind mit einem neu-japanischen Wort Fikusâ, die als Grenzgänger ihr symbolisches Kapital aus den Differenzen beziehen, die geschlossene Systeme unaufhörlich reproduzieren. Ihre Wirkung besteht in einer Universalisierung der subkulturellen Ikonen.
Öffnung heißt Zirkulationsfähigkeit. Die Ikonen der Massenkultur wie King Kong oder Michael Jackson springen mit Leichtigkeit über vom Film auf Fernsehserien, Zeitschriften, Musik, Videogames, Stoffpuppen, Schlüsselanhänger und Corn Flakes und über Kulturgrenzen. Sie konvergieren auf globale Identität, aber bislang gibt es sehr wohl noch nationale Grenzen. Games mögen eine Weltkultur sein, vorerst müssen sie der jeweiligen Zielkultur angepaßt werden. So stärkt sich in der amerikanischen Fassung von "Mega Man" der Held nicht mit Sushi, sondern mit Hotdogs. Augenformen und Beinlängen werden im Interesse interkulturelle Anschlußfähigkeit variabel. Auch stereotype Klischees müssen übersetzt werden, etwa wenn ein japanisches Game, in dem die Bösewichte ausschließlich Schwarze, Hispanics und Transvestiten sind, in die USA exportiert werden soll [Sheff 1993: 225].
Solche Stereotypen im Spiel der globalisierten Kulturindustrie sind
auch das Produkt der Wechselwirkung von Otaku und Fikusâ. In der
internationalen Verbreitung von Games und Japanimation erkennt Japan seine
Abschließung und 'virtuelle Realität' an und wendet sie positiv
im Sinne einer 'Internationalisierung aus Japan'. Otaku und Fikusâ
sind komplementäre Bündel von Operativität, die aufeinander
angewiesen sind.
Vom Animismus zur Animation
Etwas als ein 'Phänomen' identifizieren heißt, einen Erklärungsbedarf
schaffen. Warum ausgerechnet Games und warum gerade aus Japan? Darauf gibt
es verschiedene Strategien zu antworten. Eine Lesart, die man als romantische
bezeichnen könnte, sieht eine Wesensverwandtschaft der neusten Technologien
mit den ältesten Hüten des Nihonjinron.  "Eine
Antwort darauf ist es, Pachinko und Computer-Games einfach als die postmodernen
Äquivalente von Zen und Kabuki zu betrachten. Ebenso wie 'traditionelle'
Formen der japanischen Kultur verkörpern auch sie die exotische, enigmatische
und mysteriöse Essenz des japanischen Partikularismus." [Morley/Robins:
169]
"Eine
Antwort darauf ist es, Pachinko und Computer-Games einfach als die postmodernen
Äquivalente von Zen und Kabuki zu betrachten. Ebenso wie 'traditionelle'
Formen der japanischen Kultur verkörpern auch sie die exotische, enigmatische
und mysteriöse Essenz des japanischen Partikularismus." [Morley/Robins:
169]
Japanimation mag demnach aus einer Wechselwirkung mit westlichen Bild- und Comic-Stilen hervorgegangen sein, seine einzigartige Qualität wurzelt irreduzibel in traditioneller japanischer bildender und darstellender Kunst wie den Rollbilder und dem Kabuki. Auch religiöse Erklärungen nach dem Muster von Webers protestantischer Ethik sind geeignet, Heutiges in der Vorzeit zu verwurzeln. So erklärt Medienforscherin und -Kuratorin Kusahara eine besondere Affinität der japanischen Kultur zum Sodate-geemu-Genre daraus, daß der Buddhismus keinen Schöpfungsmythos und damit keine Hierarchie des Seins kenne. Im Rad der Wiedergeburt ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier nur ein vorübergehender. Die Vorstellung eines virtuellen Lebens neben dem realen sei der japanischen Kultur vertraut. Auch die Grenze zwischen belebtem Körper und Maschinenkörpern sei fließend, wie es die Androiden in solchen Japanimation wie "Gundam" und "Evangelion" zeigen [Kusahara 1997]. Schließlich läßt sich auch eine animistische Tradition in einer Medienkunst namens 'Animation' ohne Schwierigkeiten nachweisen.
Gegen die Vermutung einer Kontinuität spricht allerdings schon die linguistische Markierung, die das Katakana-Wort "geemu" von den traditionellen Spielformen des tawamure, yûgi oder asobi abhebt. Ein so markierter Bruch bestätigt eher Ohmaes These einer globalen Konvergenz innerhalb der Nintendo-Generationen.
Eine andere Lesart stützt sich auf eine wechselseitige Zuweisung von Technik und Seele. Der westliche Techno-Orientalismus assoziiert die technologischen Erfolge Japans mit einer kalten, entmenschlichten, maschinenhaften Kultur, der es an emotionaler Verbindung mit dem Rest der Welt mangele. Nach Zizeks Analyse reagiert die amerikanische Ideologie auf die wachsende ökonomische Vorherrschaft der Japaner, indem sie ihnen nicht nur einfach ihre Unfähigkeit, sich zu vergnügen vorwirft. "Es ist, als ob sie in ihrem exzessiven Verzicht auf Vergnügungen, in ihrem Fleiß, in ihrer Unfähigkeit eines 'Take-it-easy', in ihrer Unfähigkeit zu Erholung und Freude ein Genießen finden würden - und gerade diese Eigenschaft wird als eine Bedrohung der amerikanischen Vormacht angesehen." [Zizek 1992: 93 f.] Aus den stereotypischen Barbaren sind Roboter geworden, denen ihr Robotersein auch noch Spaß macht.
Den anderen wird technisch rationale Kälte unterstellt und Emotionalität
abgesprochen. Morley und Robins zitieren Jeffrey Katzenberg, den Vorsitzenden
der Disney-Studios: "Filmemachen beruht im wesentlichen auf der Übermittlung
von Emotion. 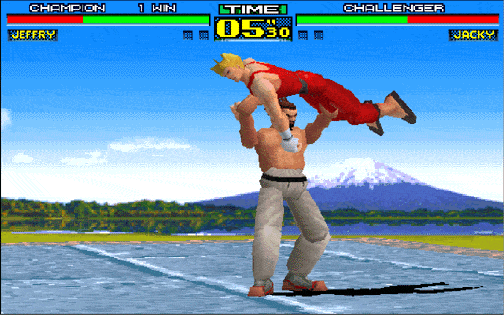 Die
Japaner unterliegen durch ihre Zurückhaltung von Gefühlen einer
kulturellen Abirrung. Wenn ich das sage, präsentiere ich nicht einfach
eine amerikanische Perspektive. Die Japaner sind die ersten, die einem
dies selbst erzählen. Dieses Gefühl von Disziplin und Selbstbeherrschung
war fraglos ein wesentlicher Faktor im japanischen Wirtschaftswunder, das
eine kleine Inselnation in eine der hervorragendsten Industrienationen
der Welt verwandelt hat." [Morley/Robins 1995: 151] Aber, so Katzenbergs
Suggestion, die Verrücktheit, der Spaß, die Unbekümmertheit
- kurz, die Emotionalität, die es zum Filmemachen braucht, ist weiterhin
in den USA ansässig. Japanische Hardware-Hersteller mögen die
Hollywood-Studios besitzen, die Filme machen sie nicht.
Die
Japaner unterliegen durch ihre Zurückhaltung von Gefühlen einer
kulturellen Abirrung. Wenn ich das sage, präsentiere ich nicht einfach
eine amerikanische Perspektive. Die Japaner sind die ersten, die einem
dies selbst erzählen. Dieses Gefühl von Disziplin und Selbstbeherrschung
war fraglos ein wesentlicher Faktor im japanischen Wirtschaftswunder, das
eine kleine Inselnation in eine der hervorragendsten Industrienationen
der Welt verwandelt hat." [Morley/Robins 1995: 151] Aber, so Katzenbergs
Suggestion, die Verrücktheit, der Spaß, die Unbekümmertheit
- kurz, die Emotionalität, die es zum Filmemachen braucht, ist weiterhin
in den USA ansässig. Japanische Hardware-Hersteller mögen die
Hollywood-Studios besitzen, die Filme machen sie nicht.
Eine genaue Umkehrung der Zuordnung von Technizität und Emotionalität
findet sich in einer Untersuchung der Bilderwelten von Videogames durch
die Mediensoziologen Shirabe und Baba [1997]. In einem Vergleich zwischen
den neuesten Game-Generationen in den USA und in Japan, in dem sie kognitive
und soziale Aspekte der Interaktion unterscheiden, kommen sie zu dem Schluß,
daß das Gewicht der Gestaltung jeweils anders gesetzt werde. Hintergrund
des Arguments ist der heutige technologische Übergang von zweidimensionaler
Computergraphik in Games und Anime hin zu dreidimensionalen, sogenannten
immersiven Environments. Bei Segas "Virtua Fighter" z.B. bestehen die Figuren
der Kämpfer aus Polygonen und Texturen, die den Regeln einer realweltlichen
Geometrie und Optik gehorchen, im Gegensatz zur flachen Graphik  von
z.B. Capcoms "Street Fighter". Auch im Internet ist dieser Trend hin zu
navigierbaren VRML-Welten (Virtual Reality Modelling Language) sichtbar.
Nachdem die japanische Unterhaltungsindustrie feststellte, daß seit
den Neunzigern fiktive Game-Figuren einen höheren Wiederekennungswert
haben, als menschliche Idoru oder Tarento, sah sie sich zu
einer Gegenoffensive gezwungen. Fernsehstationen wie Fuji TV gaben computer-animierte
Schauspieler mit der Bezeichnung "virtual Idoru" in Auftrag. Die Idoru-Agentur
Hori Pro erzielte mit "Date
Kyôko" die größte Aufmerksamkeit. DK 96, wie ihr Codename
lautet, ist ein dreidimensionaler Datensatz aus 40.000 Polygonen und stellt
eine 16-jährige Popsängerin dar. Wie andere Idoru gibt sie Interviews,
sie hat ihre eigene Radio-Show und die Presse plaudert aus ihrem virtuellen
Privatleben. Ihre Tanzbewegungen und ihre Mimik wirken realistisch, da
sie mit Hilfe des sogenannten Motion Capture von wirklichen Menschen
abgetastet werden.
von
z.B. Capcoms "Street Fighter". Auch im Internet ist dieser Trend hin zu
navigierbaren VRML-Welten (Virtual Reality Modelling Language) sichtbar.
Nachdem die japanische Unterhaltungsindustrie feststellte, daß seit
den Neunzigern fiktive Game-Figuren einen höheren Wiederekennungswert
haben, als menschliche Idoru oder Tarento, sah sie sich zu
einer Gegenoffensive gezwungen. Fernsehstationen wie Fuji TV gaben computer-animierte
Schauspieler mit der Bezeichnung "virtual Idoru" in Auftrag. Die Idoru-Agentur
Hori Pro erzielte mit "Date
Kyôko" die größte Aufmerksamkeit. DK 96, wie ihr Codename
lautet, ist ein dreidimensionaler Datensatz aus 40.000 Polygonen und stellt
eine 16-jährige Popsängerin dar. Wie andere Idoru gibt sie Interviews,
sie hat ihre eigene Radio-Show und die Presse plaudert aus ihrem virtuellen
Privatleben. Ihre Tanzbewegungen und ihre Mimik wirken realistisch, da
sie mit Hilfe des sogenannten Motion Capture von wirklichen Menschen
abgetastet werden.
Nach Shirabes und Babas Unterscheidung legen amerikanische Game-Designer Wert auf Realismus und Immersion. Der Spieler tauche ganz in die Rolle der Figur eines Soldaten, Piloten oder F1-Rennfahrers ein. Dagegen zwinge das 'typische' japanische Game den Spieler nicht, in die virtuelle Welt einzutauchen. Als Beispiel führen sie "Super Mario" an, bei dem die Spielfigur von einem externen Blickpunkt aus gesteuert wird wie ein ferngelenktes Auto. Vielmehr liege der Schwerpunkt darauf, eine empathische Beziehung zwischen Spieler und Figur herzustellen, ein emotionales Beteiligtsein. "Natürlich vernachlässigen US-amerikanische Videogame-Unternehmen nicht die Empathie des Spielers, genauso wenig wie japanische die 'Realität' des Spiels auf die leichte Schulter nehmen. Die Tatsache, daß Videogames als Produkte der japanischen Gegenwartskultur weithin in der Welt akzeptiert werden, kann jedoch nicht irrelevant sein für die Haltung zur Empathie... Amerikanische Games verbinden die Spieler mit ihrer Welt durch ihre 'Realität', während japanische die Empathie der Spieler verwenden." [Shirabe/Baba 1997] Dafür werde großer Wert auf die Konstruktion der Figur, auf ihr "Alter, Persönlichkeit, sozialen Hintergrund, persönliche Geschichte" gelegt. Es handele sich um einen kinematischen Stil, weil er wie Filmregisseure den Figuren Aufmerksamkeit schenke, selbst wenn die Details für den Spielverlauf keine große Rolle spielen.
Auch für Kyôko wurde eine ganze Lebensgeschichte entworfen.
Doch 3D-Games sind in Japan weniger beliebt und auch Kyôko wurde
vom Fan-Markt nicht angenommen. Kusahara erklärt ihr Scheitern daraus,
daß sie zu perfekt war und zugleich  als
überzeugender Menschenersatz nicht perfekt genug. Eine flache, nicht-perspektivische,
manga-hafte Darstellung von Figuren erscheine dem japanischen Auge vertrauter
und 'natürlicher' als realistische, dreidimensionale Modelle. Sie
führt dies auf die an Ukiyoe und anderer schattenloser Bildsyntax
geschulten Sehgewohnheiten zurück. In Kusaharas 'Lob des Schattens'
hallt das von Tanizaki wieder. Ein Lob nicht der Schattierungen und des
Schattenwurfs der Renaissance-Perspektive, sondern des Schattens als Figur,
als Bild [Kusahara 1997]. Tanizaki breitet in seinem Essay von 1933 [1987]
das ganze Spektrum einer Ästhetik des Halbdunkel aus, des Obskuren,
Vagen, Trüben; des Pausierens und der Auslassung; der geisterhaften
Schönheit der Frauen früherer Zeiten; der durch Einbildungskraft
einzufüllenden Andeutung; eines verschwommenen Halblichts, in dem
das, "was man sieht, zur Gedankenübertragung anregt auf das, was unsichtbar
bleibt." [Tanizaki 1987: 13] Was wiederum an McLuhans Definition des kalten,
low-definition Mediums erinnert.
als
überzeugender Menschenersatz nicht perfekt genug. Eine flache, nicht-perspektivische,
manga-hafte Darstellung von Figuren erscheine dem japanischen Auge vertrauter
und 'natürlicher' als realistische, dreidimensionale Modelle. Sie
führt dies auf die an Ukiyoe und anderer schattenloser Bildsyntax
geschulten Sehgewohnheiten zurück. In Kusaharas 'Lob des Schattens'
hallt das von Tanizaki wieder. Ein Lob nicht der Schattierungen und des
Schattenwurfs der Renaissance-Perspektive, sondern des Schattens als Figur,
als Bild [Kusahara 1997]. Tanizaki breitet in seinem Essay von 1933 [1987]
das ganze Spektrum einer Ästhetik des Halbdunkel aus, des Obskuren,
Vagen, Trüben; des Pausierens und der Auslassung; der geisterhaften
Schönheit der Frauen früherer Zeiten; der durch Einbildungskraft
einzufüllenden Andeutung; eines verschwommenen Halblichts, in dem
das, "was man sieht, zur Gedankenübertragung anregt auf das, was unsichtbar
bleibt." [Tanizaki 1987: 13] Was wiederum an McLuhans Definition des kalten,
low-definition Mediums erinnert.  Tanizaki
fragte, ob nicht, "wenn der Osten eine vom Westen völlig getrennte
wissenschaftlich-technische Zivilisation hervorgebracht hätte," darauf
basierende Apparate entstanden wären, "die besser mit unserem Volkscharakter
übereinstimmten?" [ibid: 15] Er führt unter anderem das Beispiel
des Films an, bei dem sich in Schattierung und Farbtönung, auf der
Ebene der Aufnahmetechnik, von der Art der Spielweise und Verfilmung eines
Stoffes ganz abgesehen, "irgendwie der unterschiedliche Volkscharakter"
manifestiere. "Wenn das schon beim Gebrauch derselben Apparate und Chemikalien,
desselben Filmmaterials der Fall ist, wie sehr müßte dann erst
recht eine von uns selbständig entwickelte Photographie auf unsere
Haut, unser ganzes Aussehen, unsere klimatischen und topographischen Verhältnisse
zugeschnitten sein." [ibid: 18f.] Man muß wohl schließen, daß
die Bilderwelt der Anime genau diese dem japanischen Volkcharakter angemessene
Darstellungsform ist.
Tanizaki
fragte, ob nicht, "wenn der Osten eine vom Westen völlig getrennte
wissenschaftlich-technische Zivilisation hervorgebracht hätte," darauf
basierende Apparate entstanden wären, "die besser mit unserem Volkscharakter
übereinstimmten?" [ibid: 15] Er führt unter anderem das Beispiel
des Films an, bei dem sich in Schattierung und Farbtönung, auf der
Ebene der Aufnahmetechnik, von der Art der Spielweise und Verfilmung eines
Stoffes ganz abgesehen, "irgendwie der unterschiedliche Volkscharakter"
manifestiere. "Wenn das schon beim Gebrauch derselben Apparate und Chemikalien,
desselben Filmmaterials der Fall ist, wie sehr müßte dann erst
recht eine von uns selbständig entwickelte Photographie auf unsere
Haut, unser ganzes Aussehen, unsere klimatischen und topographischen Verhältnisse
zugeschnitten sein." [ibid: 18f.] Man muß wohl schließen, daß
die Bilderwelt der Anime genau diese dem japanischen Volkcharakter angemessene
Darstellungsform ist.
Der Streit zwischen Realismus und ästhetischer Form wird auch zwischen den Otaku-Anime-ka und denen ausgetragen, die in den Mainstream abtrünnig geworden sind. Anno Hideaki lehnt Miyazakis und Oshiis Annäherung des Anime an den Echtfilm ab. Er will nicht realistischer werden, sondern gerade die durch die Beschränkung des Mediums bedingte Abstraktheit von Anime ausschöpfen. Seine Bilder tendieren zur Reduktion, werden immer einfacher und zugleich ausgefeilter [Woznicki 1998].
Das Artifizielle, das Anti-Realistische, die ästhetische Form der Beschränkung und des Weglassens verbindet sich in diesem Diskurs mit dem Emotionalsten, der Empathie zwischen Personen. In dem Argument, Charaktertiefe sei wichtiger als Raumtiefe, klingt auch Virilios Beobachtung an, daß die Tiefe des Raumes hinter der der Zeit zurücktrete, hinter der Dimensionalität der Echtzeit. "Wir sind der Meinung, Schönheit sei nicht in den Objekten selber zu suchen, sondern im Helldunkel, im Schattenspiel, das sich zwischen Objekten entfaltet." [Tanizaki 1987: 53] Es scheint, als bestimme Kimura Bins "Zwischensein" auch in der Spielewelt die sozialen und ästhetischen Beziehungen. Wie in der Gesellschaft als ganzer dient es auch in Bezug auf die Games als Sonderstellungsmerkmal gegenüber dem individualistischen, kalten und realistischen Westen.
Ungeachtet man für Shirabes und Babas Zuweisung von nationaler 'Typizität' in den Games leicht Gegenbeispiele finden wird, ist die hierdurch konstruierte Differenz bedeutsam. 'Nur' Motion-Capture dort, Emotion-Capture hier. Der Westen überschreite die Grenze der medialen Schnittstelle durch Ein-Bildung, Japan durch Ein-Fühlung. Dort Realismus und Imitation, hier Imagination und Irrealismus. "Mag sein, daß es nur ein augenblickliches, aus Licht und Dunkel zusammengebrautes Blendwerk ist. Aber uns genügt es; wir können gar nicht auf mehr hoffen." [Tanizaki 1987: 60]
Stellt man die geschilderten amerikanischen und japanischen Selbst- und Fremdzuweisungen nebeneinander - die des Disney-Chefs und die der japanischen Mediensoziologen -, so zeigt sich auf beiden Seiten der Differenz die gleiche Figur. In der eigenen Strategie gelingt die Animation, also die Beseelung der Maschinenwelt, in der anderen gelingt nur die Maschine. Das Eigene ist ganz, ein (technologischer) Leib und eine Seele, während der Andere als kalt, technokratisch, roboterhaft, lustfeindlich und amoralisch dasteht, nur halb, ohne Gleichgewicht zwischen Yin und Yang.
Das führt uns zu einem weiteren Topos im interkulturellen Diskurs über Games. Die japanische Game-Semantik kenne keine schwarz-weiß-malerische Trennung der Rollen, keine schlichte Binäropposition von Gut und Böse, in der das Spieler-Ich mit dem absolut Anderen, den Aliens konfrontiert ist, was den Einsatz der maximalen Mittel, den totalen Krieg rechtfertigt. Dem steht gegenüber, was man die Yin-Yang-Dialektik in Manga, Anime und Games nennen könnte, bei der es gilt, ein Gleichgewicht im Universum wiederherzustellen. Die Abwesenheit einer absoluten Gerechtigkeit, sagt Kusahara, sei ein weiteres wichtiges Merkmal der japanischen narrativen Strukturen. So sei in "Evangelion" und in "Mononoke-hime" keine der sich gegenüberstehenden Parteien vollständig im Recht oder im Unrecht. Es gehe zwar um Kämpfe auf Leben und Tod, aber beide Seiten haben ihre plausiblen Gründe.
Bei aller ausgleichenden Gerechtigkeit werden auch Yin und Yang als
Waffen im Kampf um das nationale Superioritätsgefühl geführt.
Oki Keisuke sagt über Games und Japanimation: "Das ist eine einzigartige
Kultur, die aus Japan kommt. Sie ist aber dennoch weiterhin kulturell ein
Schatten, Ying [sic], Hollywoods. Wenn Mickey Mouse Yang ist, dann ist
Akira Ying.... Nachdem Yang die Welt vollständig durchdrungen hat,
zeigt sich jetzt das Ying. Das Ying erhebt sich im Gefolge des Yang." [Oki
1997]
Grenzgänger
Was wir anhand der elektronischen Spiele erleben, ist die Emergenz einer vorgestellten Gemeinschaft (Benedict Anderson) von Mensch und Technologie. Sie bildet sich nicht zuletzt als Spielgemeinschaft. Der Computer, diese Spielmaschine schlechthin, ist Spielfeld und Gegenspieler. Er ist Regel und Zufall. Regeln dienen der Koordination eines außengelenkten, nicht-individuellen gemeinsamen Verhaltens, als ein Korsett für die Affirmation einer gegebenen Gruppenstruktur. Der Zufall öffnet den Möglichkeitsraum. Statt der Befolgung von Regeln erlaubt er ihre Erfindung, das Spiel mit möglichen Rollenoptionen und Identitäten. Die vermeintliche Folgenlosigkeit des Spiels reizt zu einem Experimentieren mit eingeschränktem Ernst in einem Reich der Zeichen. Sie befreit von der Grundtatsache unseres Lebens, daß wir nämlich nur eines haben. Gegen die Unausweichlichkeit des Zeitlaufs ist im Spiel immer eine neue Runde möglich.
Man kann das Internet insgesamt als ein Multi-User-Dungeon betrachten, in dem die Menschheitsfamilie unterwegs ist und sich selbst, also Monstren, begegnet. Dabei gilt es, die alten Regeln zu überprüfen und neue auszuspielen. Das betrifft auch die Meta-Regeln. Mit jedem Erziehungsspiel erziehen wir uns und unsere Kinder, die Welt der Artefakte als virtuell oder potentiell belebt zu denken.
Mit dem uns bevorstehenden Ubiquitous Computing, also subkutanen Mikroprozessoren überall eingebettet in unsere Umwelt, wird es offenbar umso dringlicher, neue Anschlüsse zu legen zwischen Technik und Seele, ein emotionales Interface zum interaktiven Gestell zu schaffen. Artificial Life und der Cyborg sind zwei Formen, unseren medialen Artefakten Autonomie zu verleihen und eine Grätsche zu vollführen vom Animismus in die kybernetische Animierung unserer Lebenswelt [vgl. Grassmuck 1988]. Es gilt mehr denn je, den Wirklichkeitssinn, mit einem Wort Musils, durch einen Möglichkeitssinn zu ergänzen.
Im Wechselspiel von Differenz und Konvergenz, von Schließung und Öffnung, in der mehrfachen Spiegelung zwischen dem 'Westen' und 'Japan' werden Bilder erzeugt, die die Aufgabe haben, eine solche Verbindung von Technik und Seele zu legen. Eine Ganzheit wird imaginiert, die der eigenen Kultur mehr oder weniger gelingt, zu der es der anderen Kultur aber an Emotionalität mangelt. Bei Nichtgelingen der Verbindung, bei einem fehlenden Äquilibrium von Yin und Yang, wird der 'Geist' wie in "Ghost in the Shell" der Manipulation durch die 'Puppenmeister' preisgegeben.
Außer der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik geht es also - trotz allem Gerede von Globalisierung - weiterhin auch um die Schnittstellen zwischen den Nationen. McKenzie Wark hat recht, wenn er schreibt, "Nintendos kultureller wie ökonomischer Erfolg signalisiert das Ende der Ära, in der Globalisierung synonym war mit Amerikanisierung." [1993: 84] Doch ist fraglich, ob sich jetzt statt dessen der universelle Bilder-Pool mit animistischen Dämonen aus Japan bevölkern wird. Das Licht der Sonne - unter dem Namen Amaterasu die höchste Gottheit des Shintô-Animismus - wird, laut Virilio, heute vom indirekten Licht der Signale in den Schatten gestellt. Dieses Licht, dieses Null-Zeichen vernichtet mit seiner Tiefe der Echtzeit nicht nur die Tiefe des realen Raums der Territorien. Es macht auch nicht nur die Grenzen zwischen Nationalstaaten und Ästhetiken hinfällig. "Museum der aufgehenden Sonne, Symbol jenes Landes des hellen Morgens, dieses fernen Ostens, der noch immer vom Aufgang des astronomischen Lichts lebt und der morgen, nicht anders als jedermann, verhüllt und begraben wird in der strahlenden Finsternis des Obskurantismus einer virtuellen Realität, wo der kybernetische Raum endgültig den Sieg über die Ausdehnung und geographische Tiefe der Welt davontragen wird." [1996: 191]

Noten und Literatur
1. S. "Rechenmaschinen und Intelligenz" (1950), in: Turing 1987: 147-182
2. s. Farmer 1990. Die neuste Fassung namens "Worlds Away" ist im Internet unter http://www.worldsaway.com zu sehen.
3. die fiktive Welt von Fukakusa heißt Tall.Grass.Muck (die Namensverwandtschaft mit dem Autor ist rein zufällig), http://ocelot.velox.com/~fukakusa/fukakusa.html
4. der sich an den des 'Orientalismus' von Edward Said anschließt.
5. bei dessen Uraufführung Gerüchten zufolge
der Stamm der Otaku sein erstes Coming-Out hatte.
Bruckman, Amy, Identity Workshop: Emergent Social and Psychological Phenomena in Text-Based Virtual Reality, April 5th, 1992. ftp://ftp.lambda.moo.mud.org/pub/MOO/papers/identity-workshop.*
Cusumano, Michael A., Japan's Software Factories. A Challenge to U.S. Management, Oxford, N.Y. etc.: Oxford Univ. Press, 1991
Dibbell, Julian, A Brief History of MUDs. From Time Immemorial to the Present, o.J., http://www.levity.com/julian/history.html
Eco, Umberto, Das Foucaultsche Pendel, dtv, München 1992
Eigen, Manfred und Ruthild Winkler, Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall, München, Piper 1975
Emmeche, Claus, Das lebende Spiel. Wie die Natur Formen erzeugt, Rowohlt, Reinbeck 1994
Farmer, Randall, Oracle Layza's Tales from Fujitsu Habitat. As lived by Tomoko Tsuchiya and re-told by F. Randall Farmer, (November 1990), http://www.communities.com/paper/layza.html
Grassmuck, Volker, Vom Animismus zur Animation, Junius Verlag, Hamburg 1988
Grassmuck, Volker, "Zum Verhältnis von Kunst und Technologie. Interview mit Asada Akira" in: Konkursbuch Japan II, Tübingen 1990, S.59-72
Grassmuck, Volker, "'Allein aber nicht einsam' - die otaku-Generation. Zu einigen neueren Trends in der japanischen Popular- und Medienkultur", in: Norbert Bolz, Friedrich A. Kittler, Christoph Tholen (Hrsg.), Computer als Medium, Fink, München 1993, S.267-296
Imai Kenichi, Toward a New Japanese Industrial System, in: Japan Echo Vol. 23, No. 4, Winter 1996, http://www.japanecho.co.jp/docs/html/230411.html
Imai Kenichi, Rethinking the Japanese-Style System, in: Japan Echo Vol. 24, No. 4, October 1997, http://www.japanecho.co.jp/docs/html/240412.html
Kusahara Machiko, Typoskript eines Vortrags gehalten auf dem "Filmwinter" in Stuttgart, Dezember 1997
Laurel, Brenda, Computers as Theater, Addison-Wesley, Reading, MASS etc. 1991
Lewin, Roger, Die Komplexitätstheorie, München 1996
Masuzoe Yôichi, Violence in Virtual Reality, in: Japan Echo Vol. 24, No. 4, October 1997, http://www.japanecho.co.jp/docs/html/240405.html
Morley, David & Kevin Robins, Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries, Routledge, London, New York 1995
Ohmae Kenichi, The Nintendo kids' brave new borderless world, The Japan Times, November 16, 1994, S. 19 und http://www.gmd.de/Japan/G7/JapaneseBackground/Press/jt_941116.html
Oki Keisuke, "Ying-Yang Theory for Movies and Computer Games", in: Telepolis, 14.2.97, http://www.heise.de/tp/deutsch/special/film/6101/1.html
Shirabe Masashi und Baba Yasunori, "Do Three-Dimensional Realtime Interfaces Really Play Important Roles?", in: Symbiosis of Human and Artifact 21B, Elsevier, S. 849-852, 1997
Tanizaki, Jun'ichiro, Lob des Schattens (In'ei raisan, 1933), Manesse, Zürich 1987
[TGM] Terebi-Geemu Museum Project, Tenshi yûgi jidai. Terebigeemu no genzai (Das Zeitalter der Fernsehunterhaltung. Die Gegenwart der Videogames), Tokyo 1994
[TGM] Terebi-Geemu Museum Project, Tenshi yûgi taizen (Enzyclopädie der Fernsehunterhaltung), Tokyo 1988
Turing, Alan, Intelligence Service, Hg. v. Bernhard Dozler und Friedrich Kittler, Brinkmann & Bose, Berlin 1987
Virilio, Paul, "Das Museum der Sonne" in: Brigitte Felderer (Hrsg.), "Wunschmaschine, Welterfindung", Springer, Wien, New York 1996, S.185-192
Wark, McKenzie, "Nintendo's New Worlds Order", in: World Art, Australien, November 1993, S. 80-84
Weizenbaum, Joseph, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, Frankfurt 1977
Woznicki, Krystian, "Towards a Cartography of Japanese Anime. Anno Hideaki's 'Evangelion'. Interview with Azuma Hiroki", in: Blimp Filmmagazine Nr. 36/1997 und http://basis.Desk.nl/~nettime/ (20.2.1998)
Zizek, Slavoj, Mehr-Genießen. Lacan in der Populärkultur,
Turia & Kant, Wien 1992